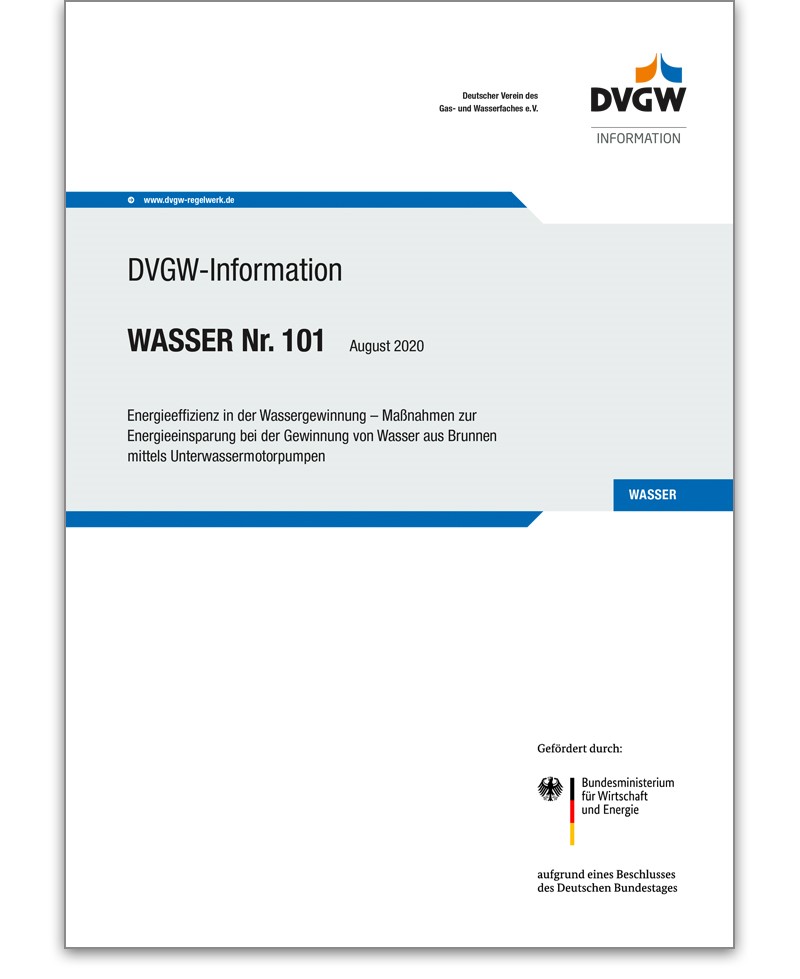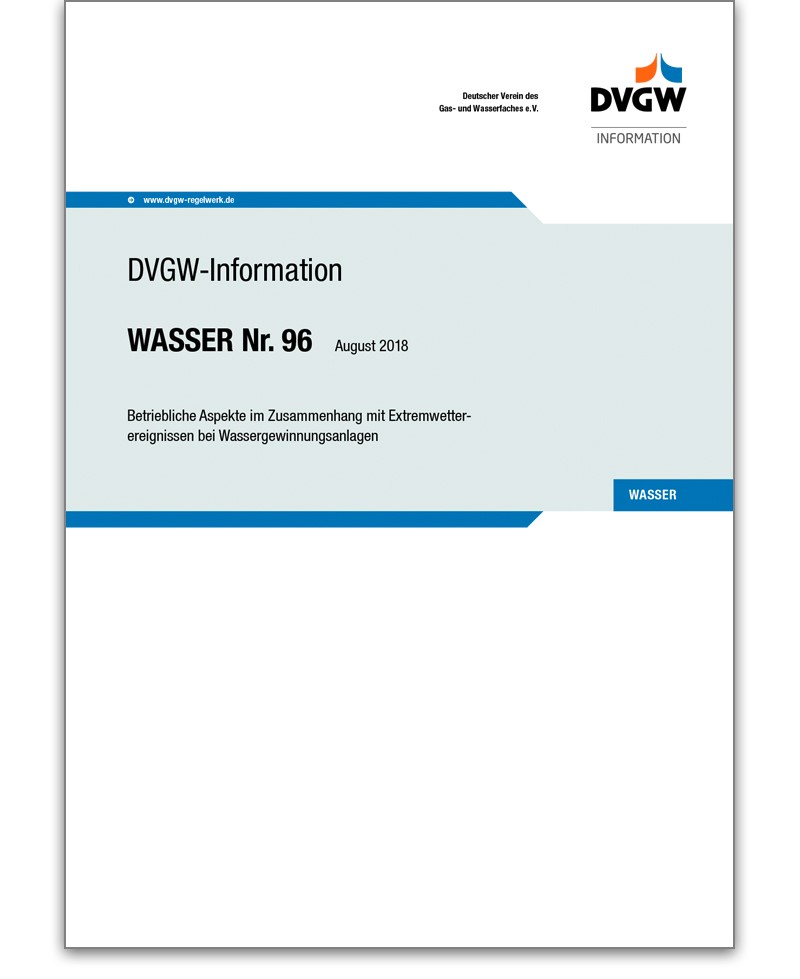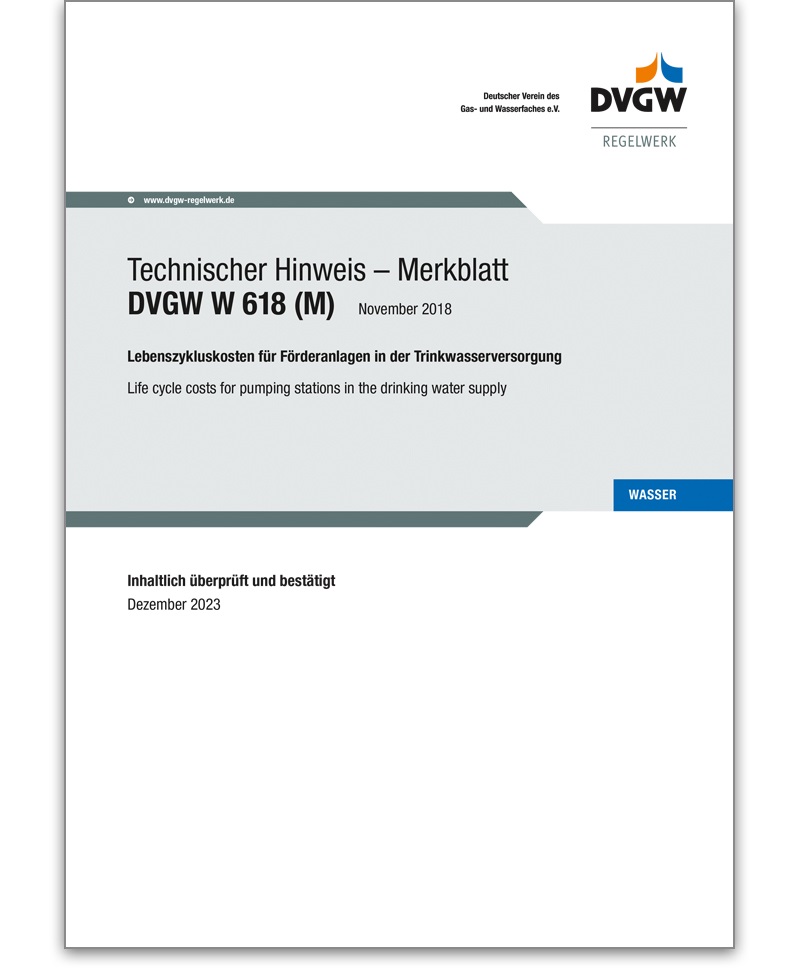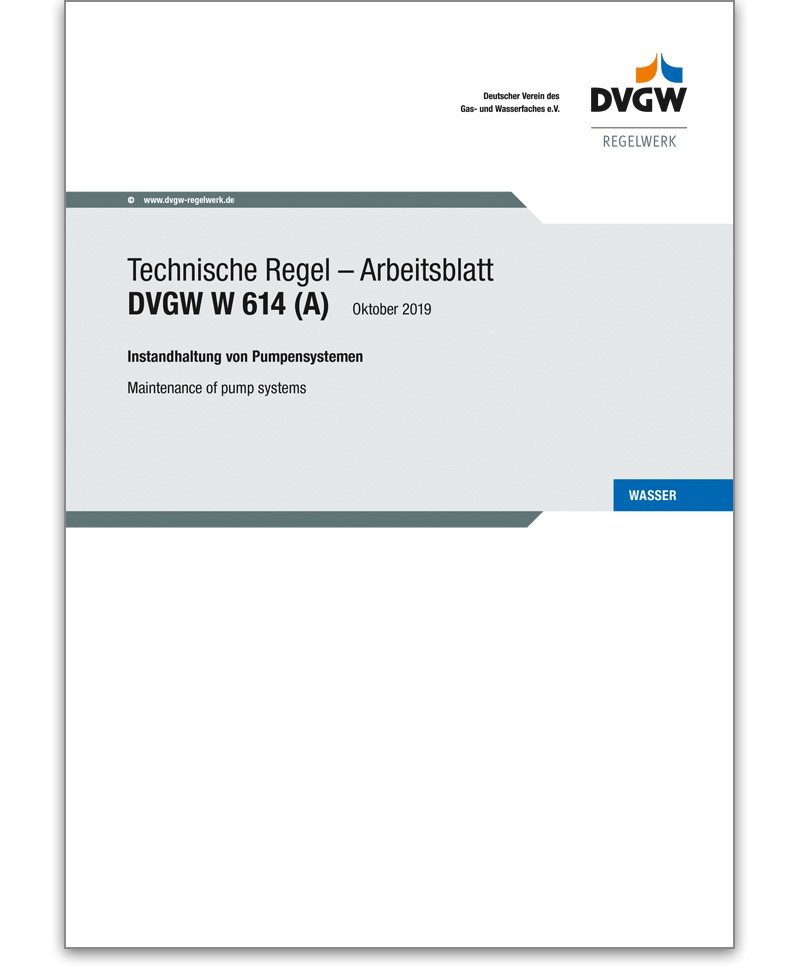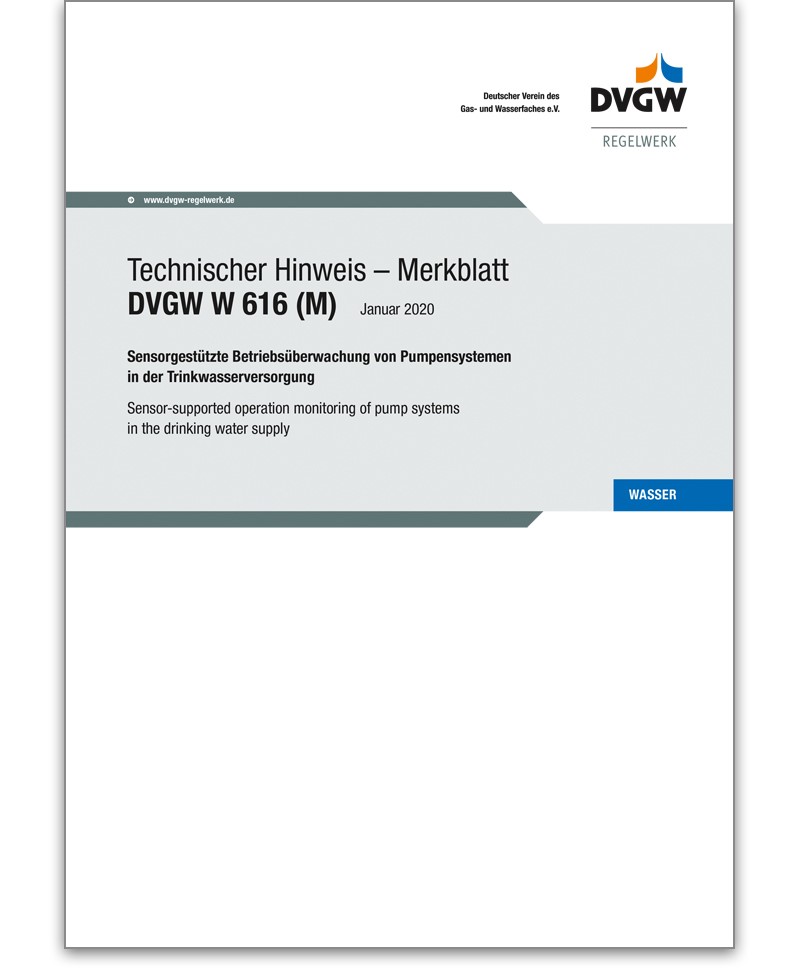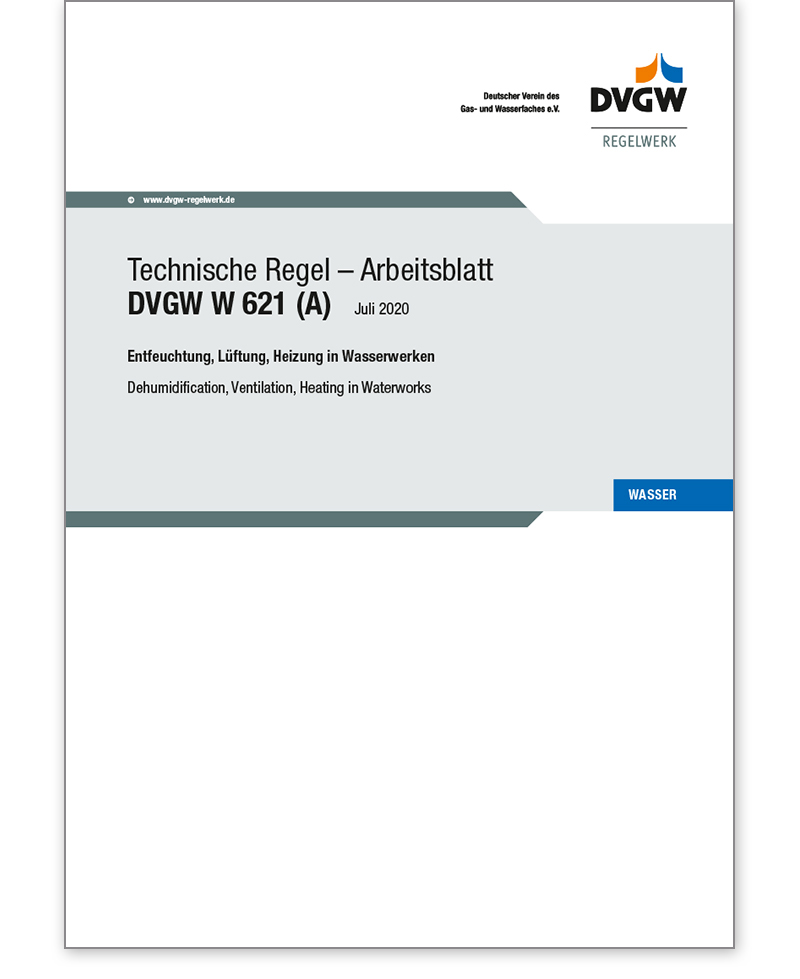DVGW-Information Wasser Nr. 101 08/2020
Energieeffizienz in der Wassergewinnung - Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Gewinnung von Wasser aus Brunnen mittels Unterwassermotorpumpen
- Herausgeber/Verlag: DVGW
- Format: 66 Seiten
- Ausgabe: 1. Auflage 2020
- Verkaufseinheit: 1
- Mindestabnahme: 1
- Artikel-Nr.: 310691
174,00 €*
Einleitung
1 Begriffe und Abkürzungen
1.1 Begriffe
1.2 Abkürzungen
2 Energieeinsparung in der Wassergewinnung
2.1 Möglichkeiten zur Energieeinsparung
2.2 Energieeinsparpotentiale
3 Messungen in Brunnen
3.1 Ausgangssituation
3.2 Messgrößen und Messkonzept
3.3 Auswahl des Messsystems für Leistungsmessungen
3.4 Messunsicherheiten und vermeidbare Fehler
3.5 Empfehlungen zu Messungen und Messsystemen
4 Energieeffizienzsteigerung in Brunnen
4.1 Ausgangssituation
4.2 Reduzierung der Druckverluste in Rohrleitungen, Formstücken und Armaturen
4.3 Reinigung von Brunnen
4.4 Reinigung von Rohwassertransportleitungen
4.5 Reduzierung des Energiebedarfs bei der Klimatisierung
4.6 Konzept für energieeffizienten Brunnenabschluss
4.7 Empfehlungen zur Energieeinsparung in Brunnen
5 Energieeffiziente Unterwassermotorpumpen
5.1 Ausgangssituation
5.2 Verwendung von energieeffizienten Antrieben
5.3 Anpassung des Gesamtwirkungsgradoptimums an den Realbetriebsbereich
5.4 Energieeinsparung durch Regelung nach dem Volumenstrom
5.5 Empfehlungen zur Energieeinsparung mit Unterwassermotorpumpen
6 Energieeffizientes Brunnenbetriebsmanagement
6.1 Ausgangssituation
6.2 Drehzahlregelung im Verbundbetrieb
6.3 Empfehlungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
TabellenverzeichnisGleichungsverzeichnis
Anhang A ? Bestimmung von Energiegrößen
Anhang B ? Angaben zu Druckverlusthöhen und Kosten mit Energiebezug bei Armaturen und Formstücken
Anhang C ? Antriebstechnologien bei Unterwassermotorpumpen
Anhang D ? Kosteneinsparpotentiale beim Einsatz von Synchronmotoren
Anhang E ? Effizienzsteigerung durch Verschiebung des optimalen Betriebspunktes
Anhang F ? Reduzierter Stromverbrauch durch Drehzahlregelung im Einzelbrunnen
Anhang G ? Zusammenhang der Anlagen- und Pumpenkennlinien bei der Drehzahlregelung von mehreren Unterwassermotorpumpen im Parallelbetrieb
Anhang H ? Reduzierter Stromverbrauch durch Drehzahlregelung in Brunnengalerie
Anhang I ? Wichtige Fragen und Übersichten mit Bezug zur Information Wasser