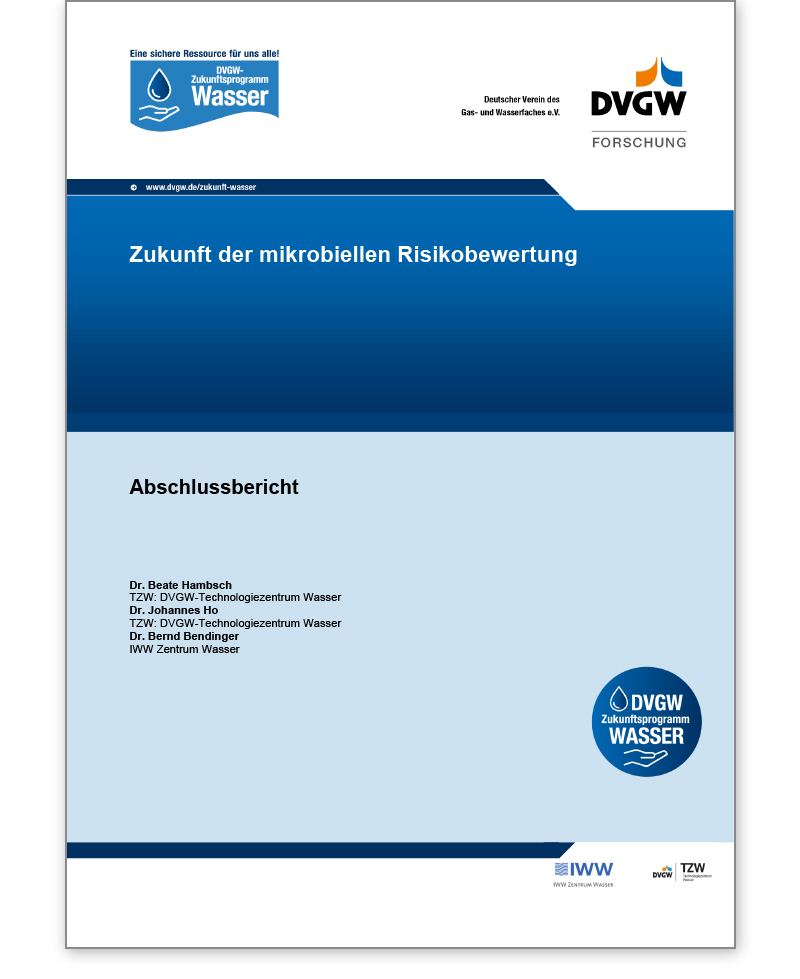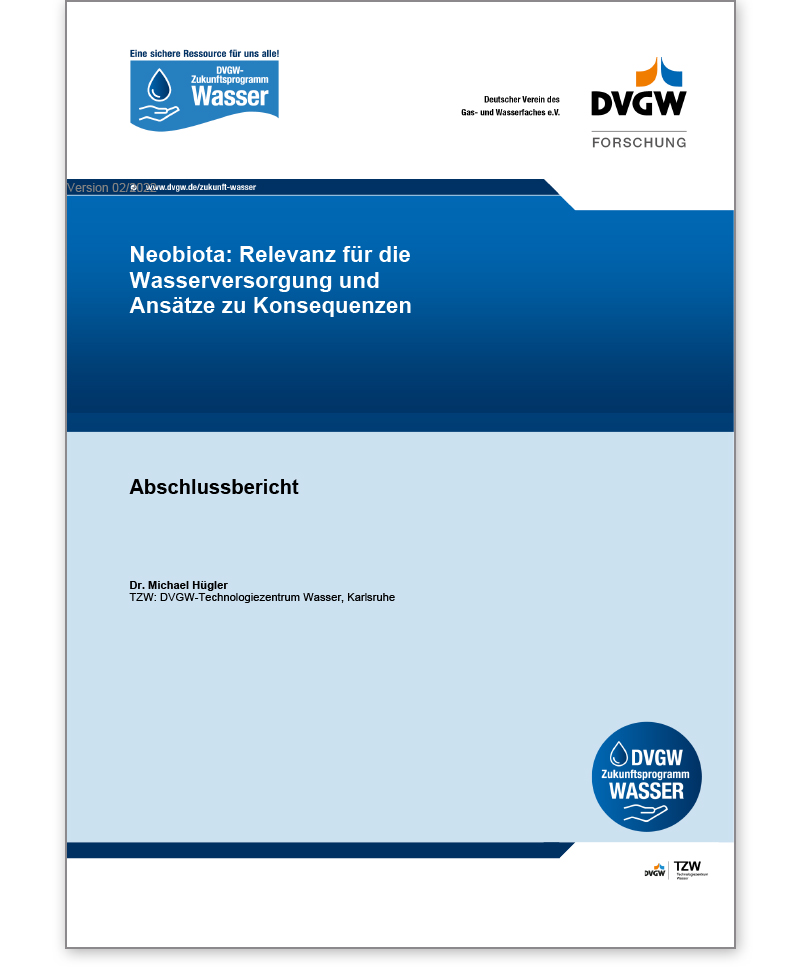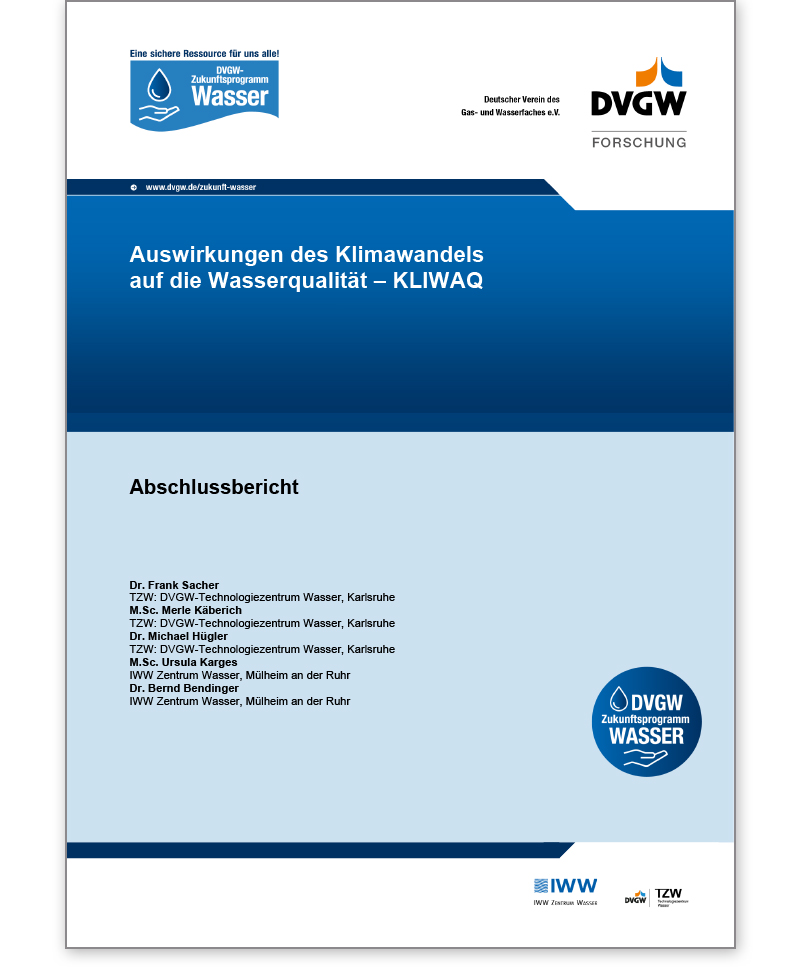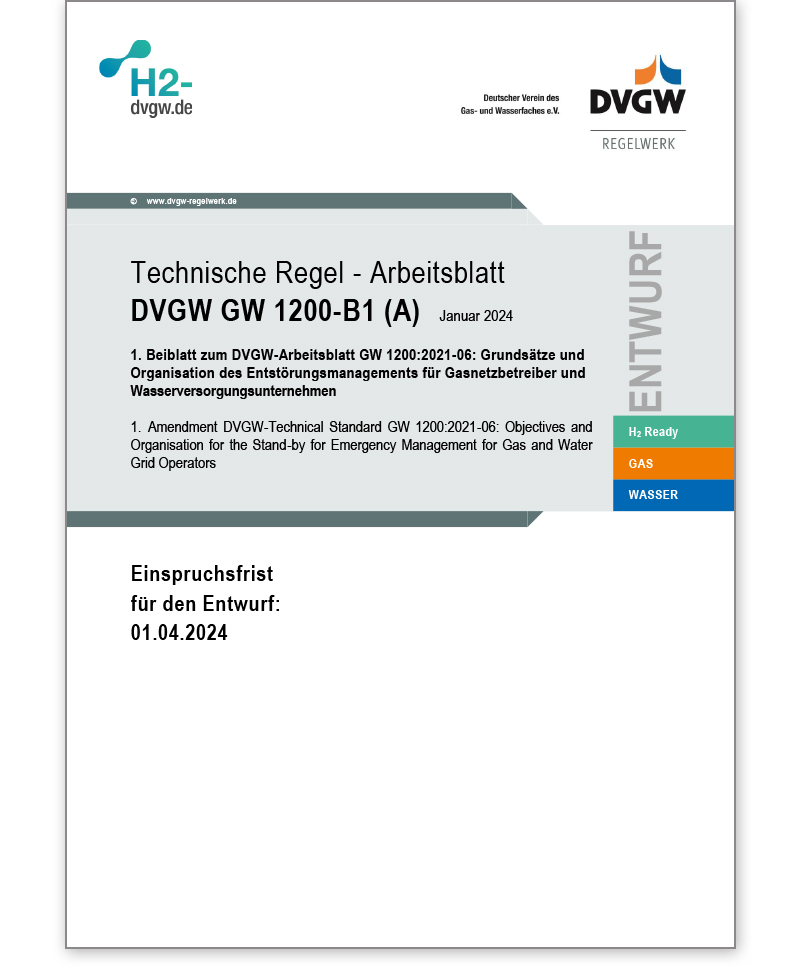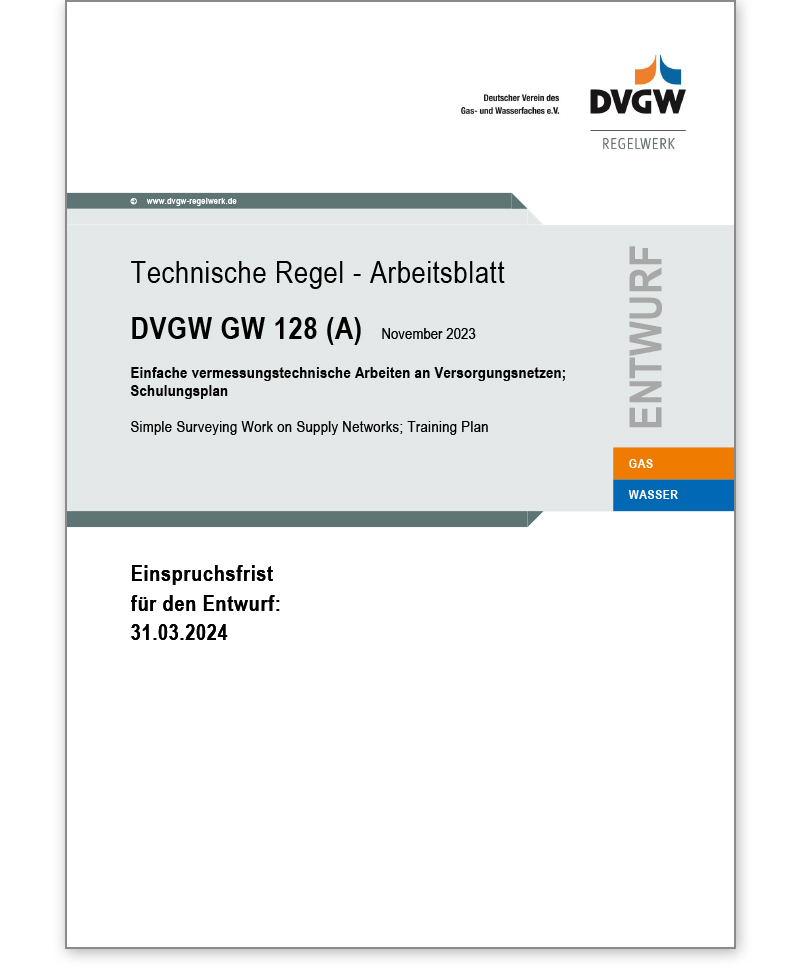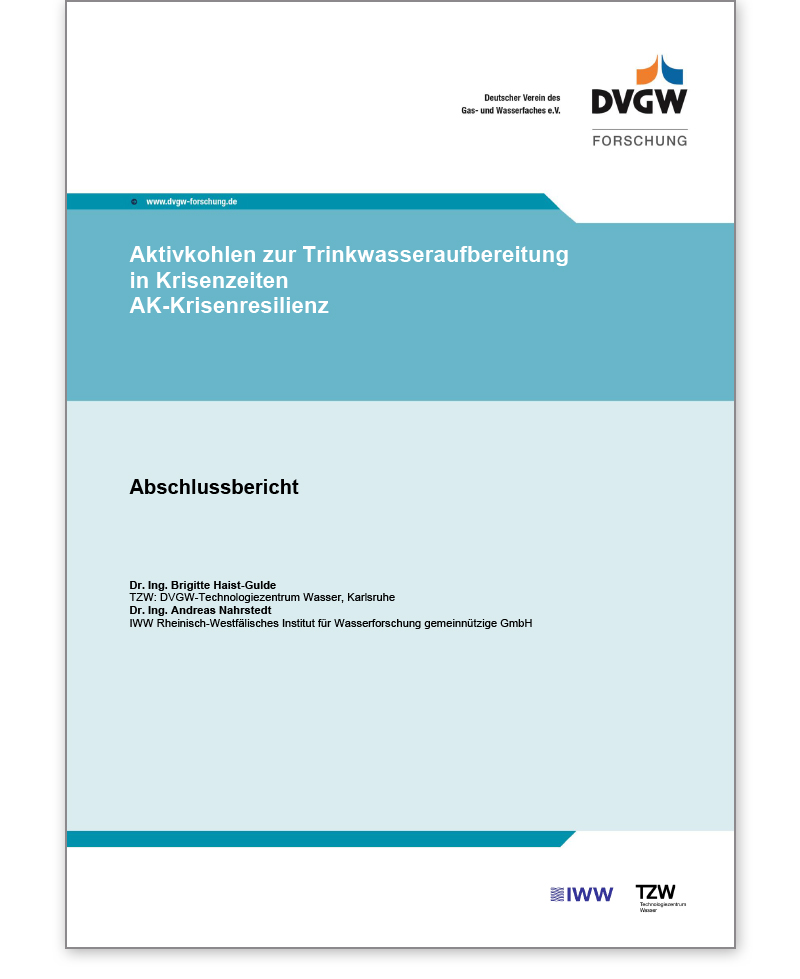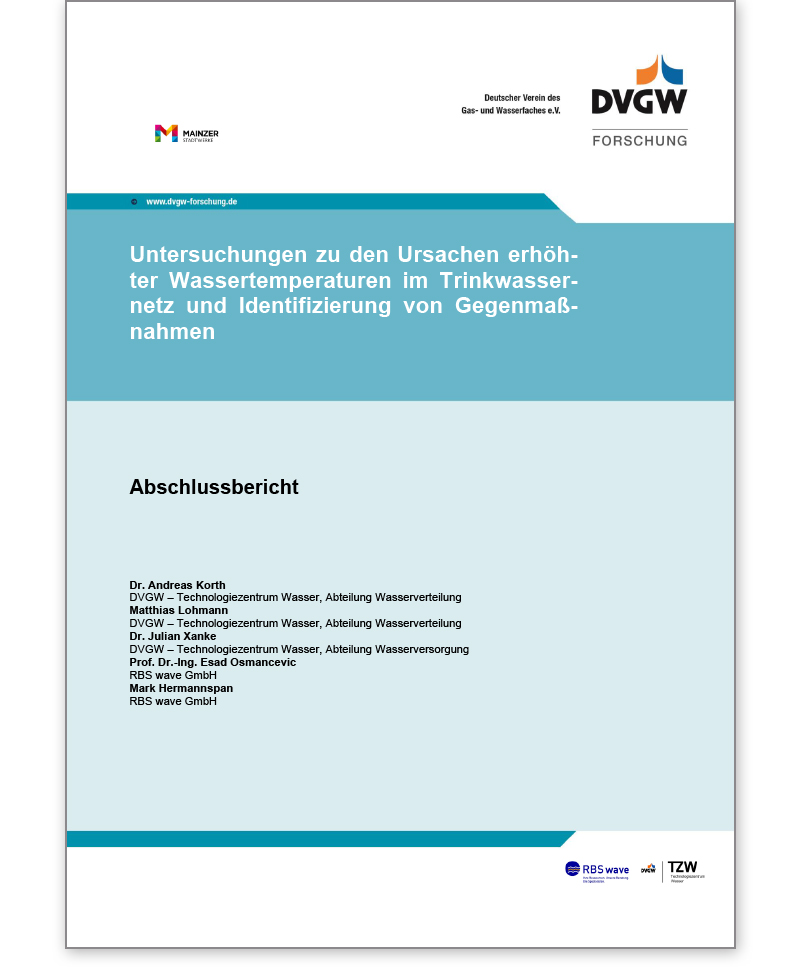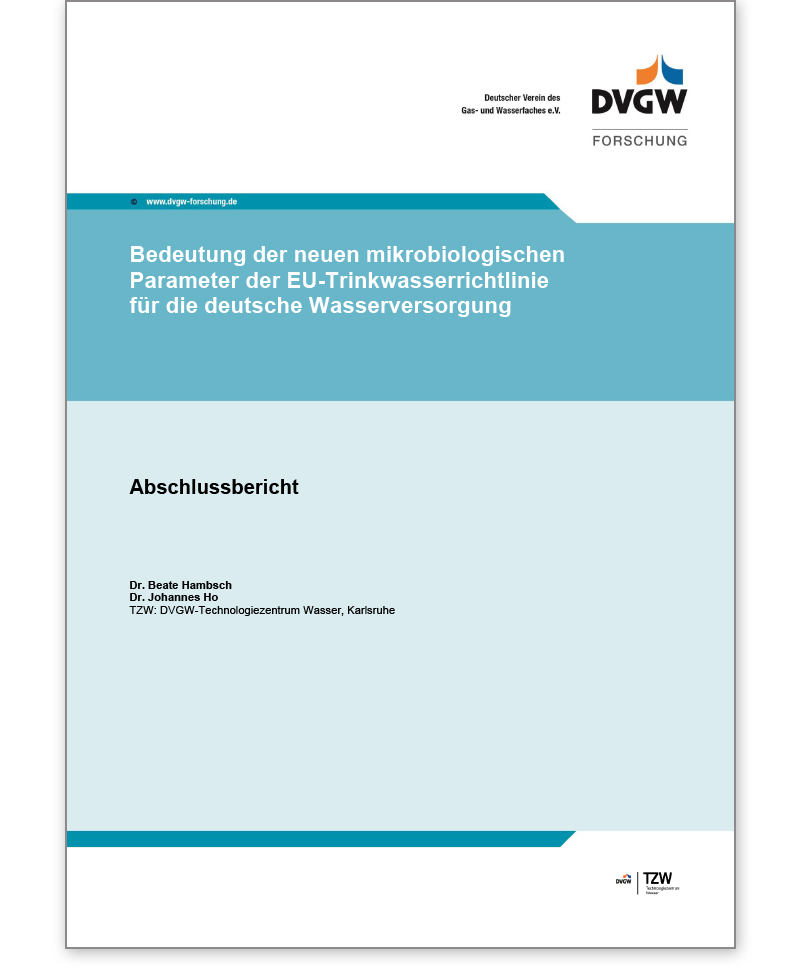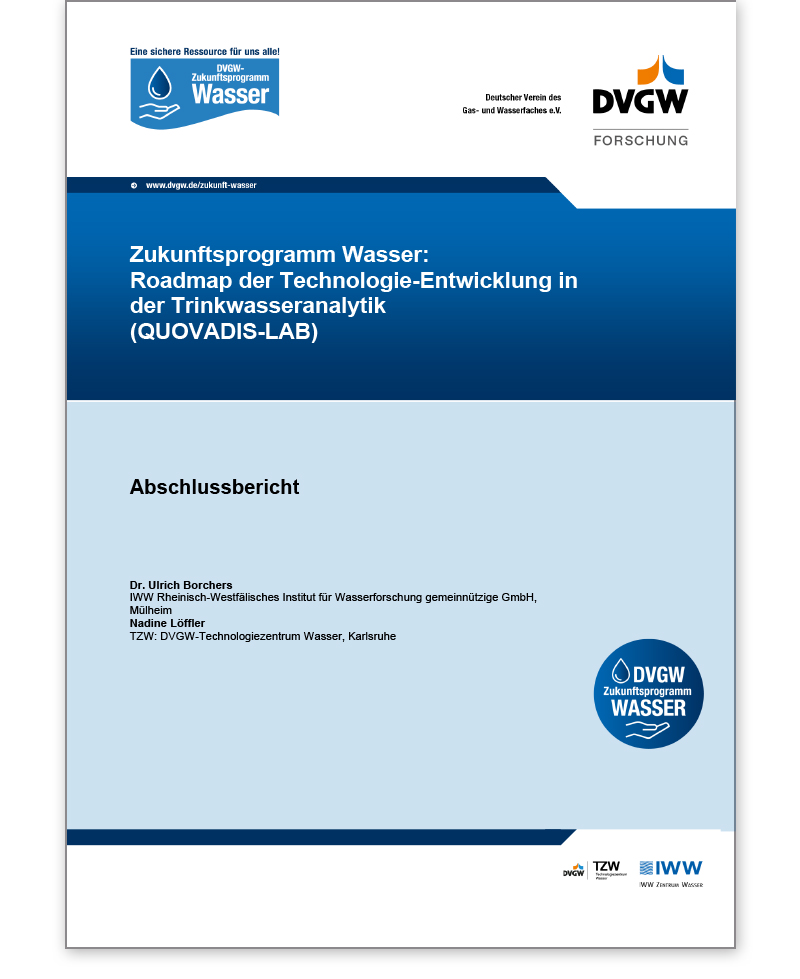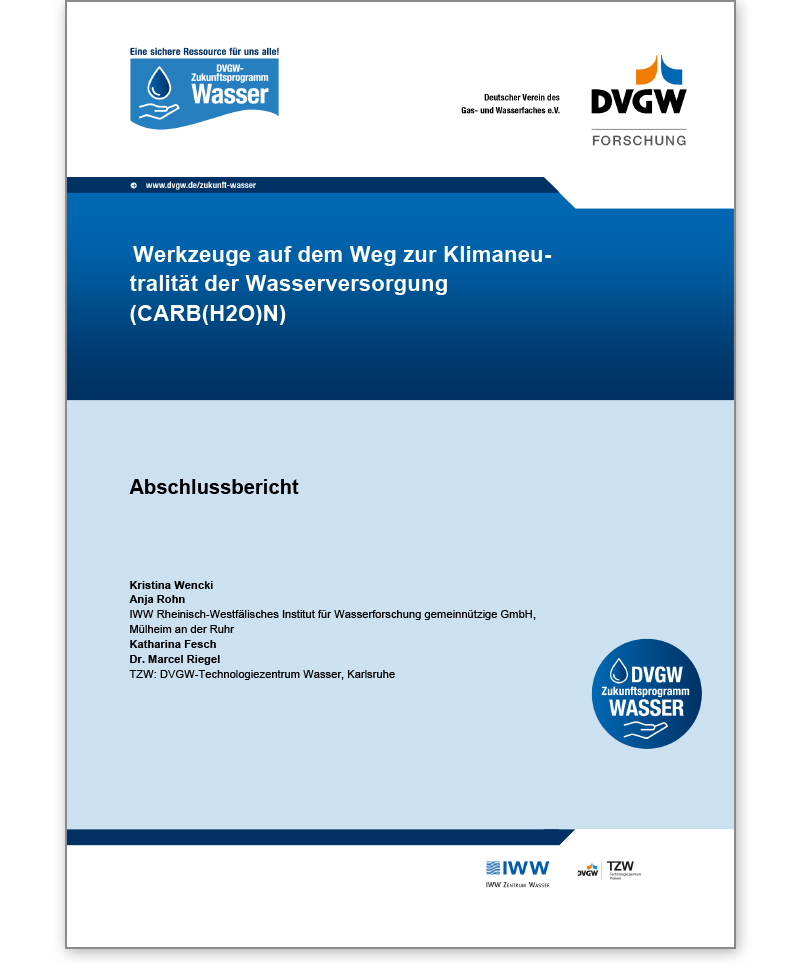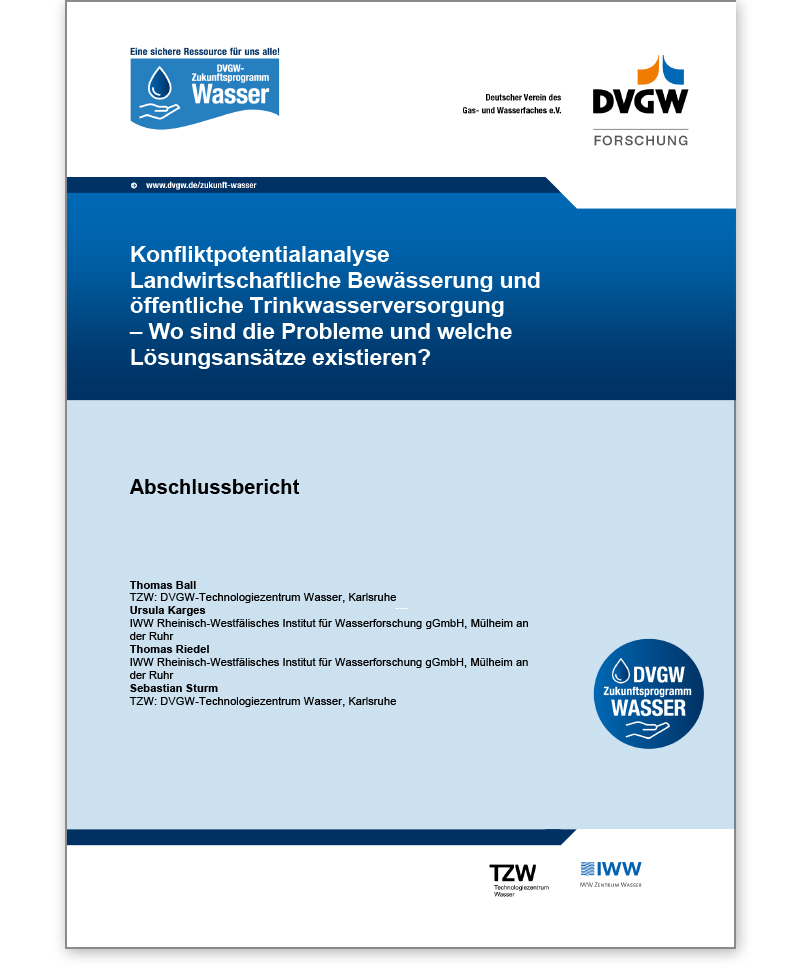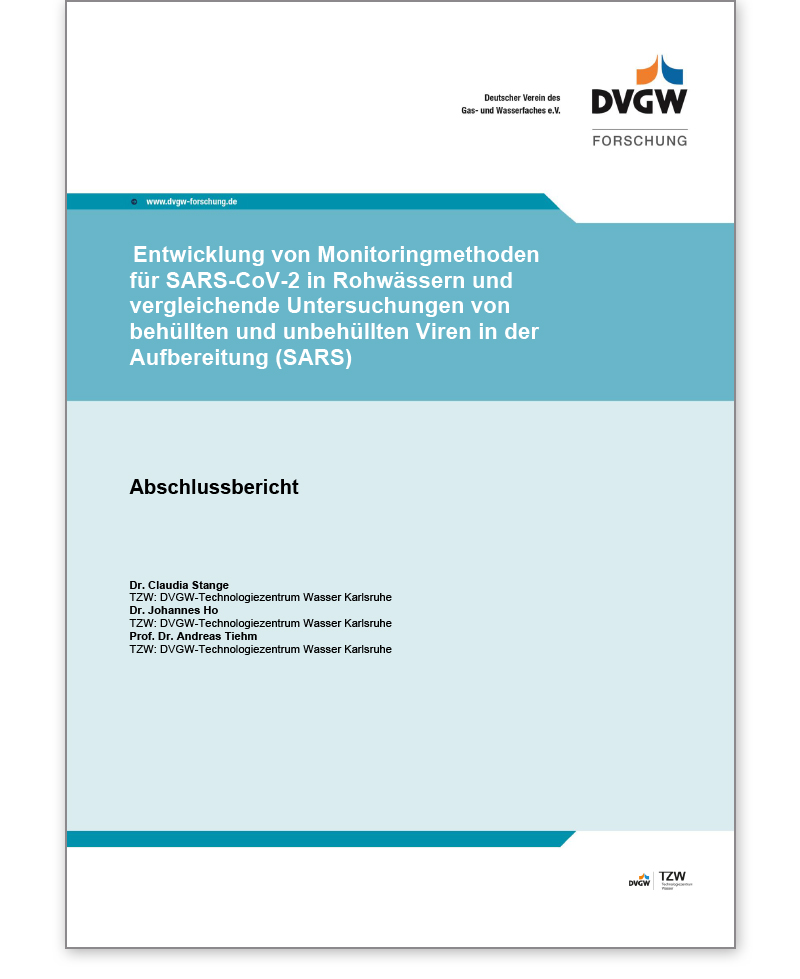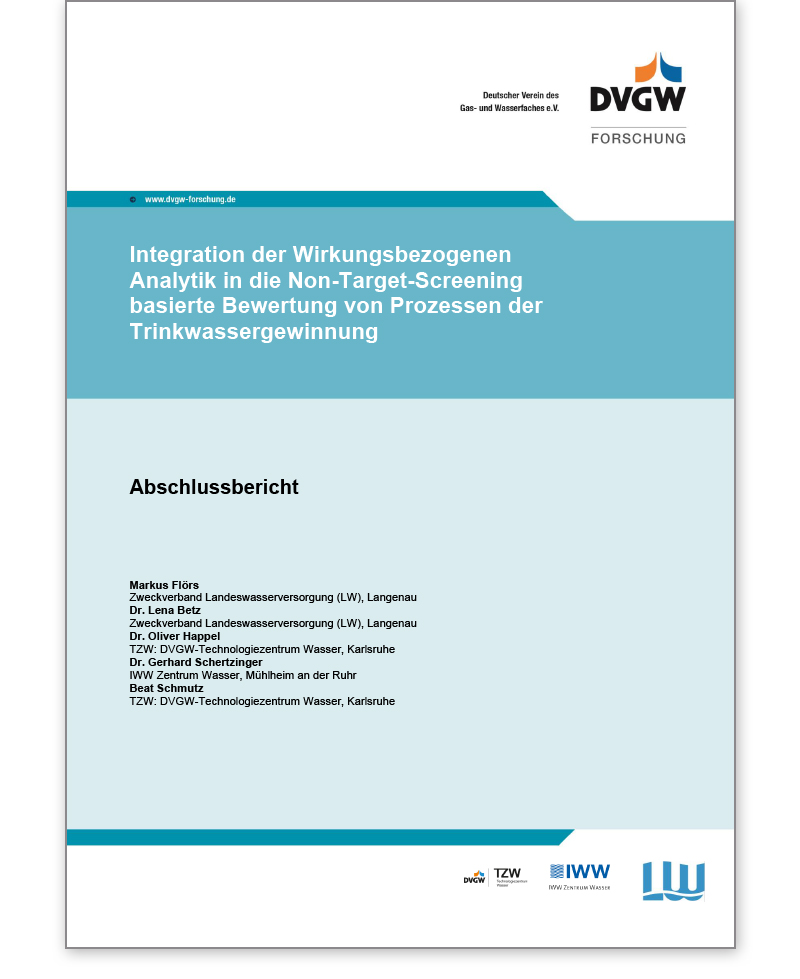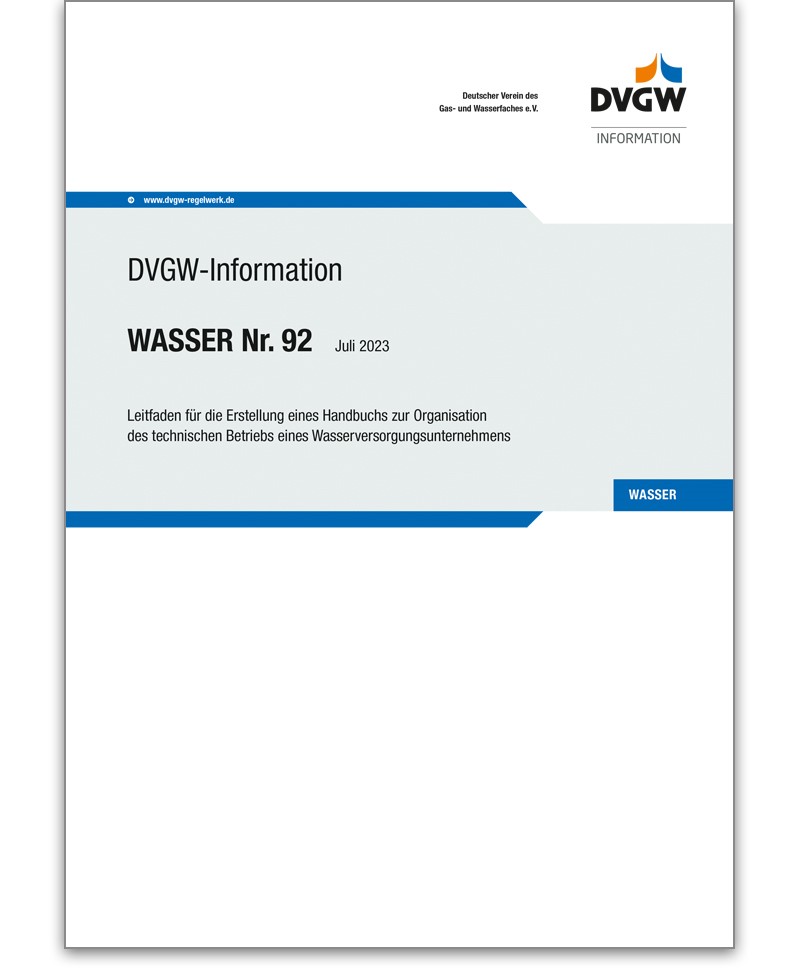Filter
–
Wasser Management
Digitalisierung, Sicherheit in der Wasserversorgung, technisches Sicherheitsmanagement, Risikomanagement sind nur einige Themen dieser Rubrik rund um die Organisation und das Management in der Wasserwirtschaft.
Forschungsbericht W 202215 03/2024
246,10 €*
Zur routinemäßigen Überwachung des Trinkwassers auf hygienische Verunreinigungen wird in Deutschland seit mehr als 100 Jahren das
Indikatorprinzip angewendet. Dabei wird die potenzielle Anwesenheit von fäkalen
Krankheitserregern über den Nachweis von fäkalen Indikatororganismen
detektiert. Aufgrund der Entwicklung der mikrobiologischen Analytik in den
letzten Jahren und der Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie, stellt sich
die Frage, welche Änderungen sich für die mikrobiologische
Trinkwasserüberwachung unter dem risikobasierten Ansatz ergeben könnte.
Im Rahmen dieser Studie Forschungsbericht W 202215 wurden die
verschiedenen methodischen Bewertungsansätze zusammengestellt, verglichen und
hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Trinkwasserversorgung in
Deutschland beurteilt. Daraus sollten Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der
Bewertungssysteme mikrobiologischer Parameter abgeleitet werden.
Um diese Ziele zu erreichen, wurde zur zentralen Erfassung der
Kenntnisse und Meinungen eine Umfrage bei deutschen WVU durchgeführt. Darüber
hinaus wurden ein online-Workshop mit der KWR (gesetzliche Regelung in den
Niederlanden) und ein Präsenzworkshop im TZW Karlsruhe durchgeführt, um eine
Diskussion auf breiter Basis zu ermöglichen. Neben WVU und DVGW-Gremien wurden
auch Behördenvertreter eingeladen.
Es zeigte sich, dass sowohl die Kommunikation des Risikos als auch eine Regelung
zur Durch-führung einer QMRA sehr komplexe Themen sind, die nicht einfach
gelöst werden können. Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass beide
Verfahren sehr unterschiedliche Zielsetzungen haben. Dementsprechend können sie
sich nicht gegenseitig ersetzen. Die Anwendung des Fäkalindikatorprinzips in
der routinemäßigen mikrobiologischen Trinkwasserüberwachung und die
Durchführung einer QMRA sind sich ergänzende Verfahren.
Forschungsbericht W 202216 03/2024
246,10 €*
Im Projekt Neobiota, Forschungsbericht W 202216, wurde der
aktuelle Kenntnisstand zu gebietsfremden Arten in Gewässern in Deutschland
zusammengetragen und in dem vorliegenden Bericht zusammengefasst. In Gesprächen
mit Fachexperten und Wasserversorgern zeigte sich, dass derzeit vor allem Oberflächengewässer
durch gebietsfremde Arten betroffen sind. Hier haben sich insbesondere Muscheln
als besonders problematisch herausgestellt. So kommt es seit der Besiedlung des
Bodensees durch die Quagga-Muschel zu großen Problemen bei den Wasserwerken am
See, da diese Muscheln die Rohwasserleitungen und die nachfolgenden
Aufbereitungsanlagen be-siedeln. Die Beseitigung der Muscheln ist mit
aufwändigen Maßnahmen und zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe verbunden. Auch
Neophyten-Bewuchs kann zu Problemen für die Wasserversorgung führen, ebenso wie
Massenvermehrungen von potentiell toxinbildenden Algen oder Cyanobakterien, die
klimawandelbedingt zukünftig häufiger auftreten könnten.
Forschungsbericht W 202127 12/2023
246,10 €*
In den letzten Jahren haben
klimatische Extremereignisse in Deutschland deutlich an Intensität und Frequenz
zugenommen. Langanhaltende Dürreperioden haben ebenso wie dramatische
Hochwasserereignisse zu massiven Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens geführt.
Die extremen Wettersituationen hatten auch weitreichende Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Neben den offensichtlichen Folgen für die Menge des
verfügbaren Wassers können sich klimatische Veränderungen auch auf die
Wasserqualität auswirken. Im Projekt KLIWAQ wurden die möglichen Auswirkungen
des Klimawandels auf die physikalische, chemische und mikrobiologische
Beschaffenheit des Roh- und Trinkwassers in Deutschland untersucht. Durch eine Umfrage, an der ca.
180 Wasserversorgungsunternehmen (WVU) teilgenommen haben, und die durch einen
Workshop ergänzt wurde, zeigte sich, dass die Auswirkungen des Klimawandels
aktuell in Deutschland vor allem WVU, die Wasser aus Flüssen, Seen oder
Tal-sperren zu Trinkwasser aufbereiten, aber auch Uferfiltratwasserwerke
betreffen. Bei WVU, die Grundwasser als Rohwasser nutzen, sind die Folgen
derzeit noch nicht in vergleichbarer Weise sichtbar. Die Unterschiede lassen
sich durch die unterschiedlichen Reaktionszeiträume und die Art der
Beeinflussung der Wasserressourcen erklären. Im Oberflächengewässer zeigen
sich Auswirkungen am schnellsten, während insbesondere im Porengrundwasser die
längsten Reaktionszeiträume und eine eher indirekte Beeinflussung vorliegen.
Langfristig sind aber auch für die WVU, die Grundwasser nutzen, Auswirkungen zu
erwarten.
Unabhängig von der Art des
Rohwassers wurden Temperaturveränderungen mit Abstand am häufigsten als bereits
heute auftretender Effekt genannt. Weitere mögliche Veränderungen der
Wasserbeschaffenheit als Folge des Klimawandels, die bereits heute vereinzelt
auftreten, betreffen ein geändertes Spektrum an organischen Spurenstoffen und
erhöhte Gehalte an Nährstoffen und anorganischen Inhaltsstoffen wie Eisen oder
Mangan. Auch bei den biologischen und mikrobiologischen Parametern ist mit
einer Veränderung des Spektrums, aber auch mit einem vermehrten Auftreten von
Krankheitserregern zu rechnen.
In Bezug auf zukünftige
Entwicklungen wurde in der Befragung deutlich, dass ungefähr die Hälfte der WVU
in der Zukunft verstärkte Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität
erwartet. Die unterschiedlich starken Auswirkungen abhängig von der Rohwasserart
sind bei den Zukunftserwartungen nicht mehr von großer Bedeutung. Gleichzeitig
ist bemerkenswert, dass etwa die Hälfte der WVU keine zunehmenden Auswirkungen
in der Zukunft erwartet, obwohl der Klimawandel und seine Folgen seit Jahren
stark diskutiert werden.
Die Ergebnisse des Projekts
zeigen auch, dass die zur Verfügung stehende Aufbereitungstechnik i. d. R.
ausreichend zu sein scheint, um die derzeitigen und in Zukunft zu erwartenden
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserbeschaffenheit zu beherrschen. Ist
eine zusätzliche Aufbereitung notwendig, sind jedoch auch immer die steigenden
Kosten für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu
beachten. Akuter Handlungsbedarf für die WVU in Deutschland lässt sich – mit
Ausnahme weniger Einzelfälle, beispielsweise einige Talsperrenwasserwerke, die
Probleme durch massive Waldschäden im Einzugsgebiet haben – aus den Ergebnissen
der vorliegenden Studie nicht ableiten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserbeschaffenheit in Deutschland in
ihrer Bedeutung wesentlich geringer sind als die Probleme, die mit einer
eingeschränkten Verfügbarkeit von Wasser verbunden sind.
GW 1200-B1 Entwurf Arbeitsblatt 01/2024
Preis ab:
39,92 €*
Das DVGW-Arbeitsblatt GW 1200-B1 Entwurf ändert das DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 in den Abschnitten 1, 2 und 3.Mit dem DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 06/2021 wurde ein grundsätzlicher Rahmen geschaffen, der die wesentlichen Anforderungen an das Entstörungsmanagement von Gasnetzbetreibern und Wasserversorgungsunternehmen festlegt.
GW 128 Entwurf Arbeitsblatt 11/2023
Preis ab:
62,03 €*
Dieses Arbeitsblatt GW 128 Entwurf gilt für einfache vermessungstechnische Arbeiten und die Erstellung der zugehörigen Aufnahmeskizze.
Einfache vermessungstechnische Arbeiten sind Vermessungen, die unter anderem mit dem Messband (auch einfache Laserentfernungsmessgeräte), Winkelprisma und Fluchtstäben unter Anwendung von Orthogonal-, Einbinde- und Bogenschlagverfahren durchgeführt werden können.Durch die gezielte Schulung soll die Qualität im Bereich der Leitungsdokumentation in der Gas- und Wasserversorgung verbessert werden. Gemäß DVGW GW 120 (A) sind einfache Vermessungsarbeiten durch entsprechend geschultes Personal auszuführen. Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes kann die Sachkunde für einfache Vermessungsarbeiten vermittelt werden.
Es beinhaltet die allgemeinen Regelungen der Schulung „Einfache vermessungstechnische Arbeiten“ und legt die Schulungs- sowie Prüfungsinhalte fest.
Forschungsbericht W 202219 09/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens W 202219 besteht in
der Zusammenstellung des Expertenwissens bezüglich der Rohstoff- und
Energiesituation bei der Aktivkohleherstellung, der Eigenschaften der
unterschiedlichen Aktivkohlen sowie den Erfahrungen im Bereich der Optimierung
des Aktivkohleeinsatzes bei Wasserversorgungsunternehmen. W 202219 zeigt Alternativen
zum Einsatz von Aktivkohlen auf und bewertet diese.
Lieferengpässe im Jahr 2022 waren darauf zurückzuführen,
dass pandemiebedingt die Lieferkette nur eingeschränkt funktionierte. Aktuell
hat sich diesbezüglich die Situation wieder entspannt. Doch auch zukünftig muss
mit Krisensituationen gerechnet werden. Daher ermittelt dieses
Forschungsvorhaben W 202219 Grundlagen, wie auf solche Krisen reagiert werden
kann.
Im Zusammenhang mit einem resilienten Umgang von Aktivkohle
ist ein erster Schritt die Prüfung von Maßnahmen für eine Minimierung des
Aktivkohlebedarfs, wie sie in W 202219 zusammengestellt sind. Dies beinhaltet
auch die Möglichkeit der Reaktivierung.
Forschungsbericht W 201904 06/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Der globale Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf
viele Bereiche der Umwelt, wobei die Zunahme von Hitzeperioden in den
Sommermonaten, die zu einer zunehmenden Erwärmung der Umwelt führen, eine
besonders relevante Auswirkung darstellen. Von dieser Erwärmung sind auch die
Bodenzonen betroffen, in denen die Trinkwasserleitungen verlegt sind. Inwieweit
das Trinkwasser in Trinkwasserrohrnetzen in Deutschland von einer Erwärmung
betroffen ist, wurde bisher nicht wissenschaftlich untersucht.
Der Ansatz des Forschungsprojektes W 201904 bestand darin,
die Prozesse der Erwärmung zu untersuchen und für die Praxis Ansätze zur
Bewertung der Temperatursituation im Trinkwasserrohrnetz zu entwickeln. Das
übergeordnete Ziel bestand darin, Grundlagen für verschiedene Handlungsfelder
zum Umgang mit der Problematik hoher Wassertemperaturen im Trinkwasserrohrnetz
zu erarbeiten.
Zur Berechnung der Bodentemperaturentwicklung wurde ein
numerisches Bodenmodell entwickelt, mit dem auch der Effekt weiterer
Wärmequelle berücksichtigt werden kann. Ein einfacher Ansatz zur Abschätzung
des Erwärmungsrisikos im Trinkwasserrohrnetz ist die Verwendung von
Satellitendaten und die Einteilung der Netzbereiche entsprechend angenommener
hydraulischer Bedingungen.
Im Ergebnis des entwickelten Prozessverständnisses lassen
sich längerfristige Maßnahmen zur nachhaltigen Beherrschung der
Temperaturproblematik ableiten. Die entwickelten Ansätze können genutzt werden,
um zu prüfen, welche Maßnahmen in der Praxis unter welchen Rand-bedingungen
tatsächlich nachhaltig sind. Für das Regelwerk W397 leitet sich ein Überarbeitungsbedarf,
insbesondere für die Annahme der charakteristischen Sommertemperatur, ab.
Forschungsbericht W 202012 06/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
In der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie (EU-DWD) wurde ein
risikobasierter Ansatz (risk based approach) aufgenommen, in dem u. a.
vorgesehen ist, das Rohwasser und bei Überschreiten des Referenzwertes von 50
PFU / 100 mL auch das Wasser innerhalb der Aufbereitung auf „somatische
Coliphagen“ zur Erfassung des mikrobiellen Risikos insbesondere durch fäkale
virale Krankheitserreger zu untersuchen. Der Parameter „somatische Coliphagen“
dient zur Verifizierung der Entfernungswirksamkeit der Aufbereitung für Viren
bzw. Partikel im Größenbereich von Viren.
Im Rahmen dieses Vorhabens W 202012 wurden Rohwässer mit
unterschiedlich starkem Einfluss von Oberflächenwasser in Form von Flusswasser
ausgewählt (direkte Aufbereitung (< 1 h), kurze Bodenpassage (5 d), lange
Uferfiltration (50 d) und sehr lange Uferfiltration (> 100d)), in denen
spezifische Untersuchungen auf bakterielle und virale Krankheitserreger mit
kulturellen und PCR-Verfahren sowie Indikatoren durchgeführt wurden. Als
Oberflächenwasser wurden jeweils Flusswässer gewählt, da nur diese eine
ausreichend hohe mikrobiologische Ausgangsbelastung enthalten, um einen
Log-Rückhalt durch Partikelentfernung berechnen zu können.
Durch die Untersuchungen von vier Wasserversorgungen, die
Flusswasser zur Trinkwasser-aufbereitung nutzen, konnten Rohwässer mit
unterschiedlichen Aufenthaltszeiten in der ersten partikelentfernenden Stufe
(in der Wasseraufbereitung bei direkter Flusswasseraufbereitung und im
Untergrund bei Bodenfiltraten und Uferfiltraten) betrachtet werden.
In drei der vier Flusswässer lagen die Mittelwerte der
Konzentrationen der somatischen Coliphagen oberhalb des Referenzwertes von 50
PFU / 100 mL, die gemäß EU-DWD eine Bewertung der Wirksamkeit der
Aufbereitungsverfahren erforderlich machen.
Eine starke Oberflächenwasserbeeinflussung wurde bei den
Wasserversorgungsunternehmen mit kurzen Fließzeiten (< 1h (direkte
Aufbereitung), 5 d Bodenpassage) festgestellt, eine sehr geringe bzw. kaum
nachweisbare Oberflächenwasserbeeinflussung bei den Uferfiltraten mit langer
Fließzeit (50 d, > 100 d).
Diese Beeinflussung ließ sich einerseits aus den
historischen Daten erkennen, da hier bei den stark beeinflussten Wässern die
Häufigkeit von Positivbefunden coliformer Bakterien in den Rohwässern noch fast
100 % beträgt, während bei den kaum beeinflussten Rohwässern mit den langen
Bodenpassagen die Häufigkeit unter 1% lag. Andererseits zeigten auch die erreichbaren
Rückhalte und auch die quantitative mikrobielle Risikobewertung, dass diese für
die langen Aufenthaltszeiten im Untergrund ein mögliches Gesundheitsziel von
10-4 Infektionen pro Person und Jahr erreichen.
Eine Untersuchung auf somatische Coliphagen zur
Risikobewertung ist bei den hochbelasteten Flusswässern auf jeden Fall
sinnvoll, bei den Boden- oder Uferfiltraten dagegen nur bei solchen mit kurzen
Fließzeiten im Untergrund.
Forschungsbericht W 202126 03/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die QUOVADIS-LAB-Studie konnte ein sehr positives Bild der
aktuellen Trinkwasseranalytik und deren Entwicklung darstellen. Die Hersteller
der Analysengeräte greifen mit ihrem Unternehmergeist dynamisch Tendenzen und
Bedarfe am Markt auf und setzen sie in Kooperation mit ihren Kunden in gute
Lösungen um. Der Treiber „Gesetzgebung“ wird sowohl von Wasser-versorgern als auch
von Herstellern als positiv und innovationsfördernd angesehen. Schwerpunkte
der Entwicklung sehen die Hersteller eher bei den Generalthemen Automatisierung
und Digitalisierung, während Wasserversorger stärker den Fokus auf den Ausbau
der Spurenstoffanalytik sowie den modernen mikrobiologischen Ansätzen und der
online-Sensorik sehen.
In der mikrobiologischen Analytik sollten die
molekularbiologischen Verfahren, mit denen bakterielle Kontaminationen
schneller und effektiver erfasst werden können als mit klassischen
Kulturverfahren, gefördert und für die Überwachung hoffähig gemacht werden.
Für die chemische Analytik ist zu erwarten, dass zukünftig
vermehrt Analyseverfahren gebraucht werden, die mit Screening-Ansätzen noch
mehr Stoffe in sehr niedrigen Konzentrati-onen erfassen können. Die aktuell
erreichbaren Bestimmungsgrenzen in der Region von 1-10 ng/l scheinen dabei als
ausreichend. Es wurde gezeigt, dass die verfügbaren Budgets und Ressourcen
besser in eine breitere statt eine „tiefere“ Analytik investiert werden
sollten.
Die Target-Analytik behält aller Voraussicht nach weiterhin einen
sehr hohen Stellenwert. Parallel dazu scheint es sinnvoll zu sein, dass
Screening-Verfahren weiter vorangebracht werden, so dass die Vorteile beider
Ansätze sinnvoll vereint werden.
Die Mikroplastik-Analytik im Trinkwasser ist vermutlich für
die Routineüberwachung nicht erforderlich.
Es wäre wünschenswert, im Trinkwassersektor mehr auf eine
ganzheitliche Betrachtungs-weise der Wirkung des Trinkwassers auf den Menschen
zu setzen. Dafür ist die wirkungsbe-zogene Analytik (WBA) gut geeignet.
Mit der neuen Trinkwasserverordnung wird der Weg einer
amtlichen betrieblichen online-Überwachung bestimmter Parameter frei gemacht.
Eine ganz wesentliche Entwicklung wird die Veränderung des
Einsatzes von Analytik im Umfeld des verpflichtenden Risikomanagements nach
TrinkwV darstellen. Mit dem Risikoma-nagement werden flexible neue oder
veränderte Ansätze gebraucht werden. Hierbei sind Kreativität und Innovationen
gefragt.
Die Flut an Daten aus allen Teilbereichen der Analytik muss
durch eine angemessene und zielgruppenorientierte Risikokommunikation begleitet
werden. Dieser Aspekt ist zu intensivieren, da es neben der Erfüllung von
Überwachungspflichten darum geht, dass die Ergebnisse verständlich erklärt und
deren Bedeutung transparent gemacht und eingeordnet wird.
Im Projekt zeigte sich auch deutlich, dass alle Bereiche der
Analytik von einer weiteren Digitalisierung und Automatisierung profitieren
würden.
Begleitend sollte auch die zukünftig zunehmende Bedeutung
der „grünen analytischen Chemie“ im Blick behalten werden. Analytische
Verfahren im Umweltbereich sollten möglichst umwelt- und ressourcenschonend
sein.
Forschungsbericht W 202213 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die Zielsetzung des Forschungsberichtes W 202213 bestand daher in der Zusammenstellung der erforderlichen Wissensgrundlagen zur Entwicklung einer branchenspezifisch einheitlichen Vorgehensweise zur vollständigen, kennzahlenbasierten Ermittlung der Emissionen der Wasserversorgung, die durch die Unternehmenstätigkeit verursacht werden.Als erforderliche Wissensgrundlagen wurden vor Projektbeginn eine pragmatische Definition der Klimaneutralität in der Wasserversorgung, ein Begriffsglossar zur Klimaneutralität unter Berücksichtigung der ISO-Normung und eine Beschreibung und Interpretation der Inhalte der ISO-Normung sowie weiterer branchenspezifischer Standards und Regelwerke zur Klimaneut-ralität in der Wasserversorgung erachtet. Zusätzlich sollten Abgrenzungen und Schnittstellen zur Bilanzierung in der Abwasserwirtschaft definiert werden und ein Vorschlag zur weiteren gemeinsamen Bearbeitung des Themas für eine integrierte Bilanzierung der Treibhausemissi-onen der Wasserwirtschaft erarbeitet werden. Ein zentrales Ergebnis dieser verschiedenen Analysen und Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Grundlagen stellt die Ableitung eines Gliederungsvorschlags für eine Handreichung zur Treibhausgasbilanzierung und zum Klimamanagement in der Wasserversorgung dar, welche als Arbeitsgrundlage zur weiteren Bearbeitung an den PK-Klimaneutralität des DVGW übergeben wird. Der Arbeitsschritt der Definition von Schnittstellen zur Bilanzierung in der Abwasserwirtschaft und Ableitung von Potenzialen zur Harmonisierung der Methoden und branchenübergreifen-den Zielsetzungen zur Klimaneutralität in der Wasserwirtschaft wurde im Rahmen des Kickoff-Meetings zum Projekt in Übereinkommen mit der Projektbegleitgruppe als innerhalb der Pro-jektlaufzeit nicht realisierbar deklariert. Eine Abstimmung mit der DWA zur weiteren Harmoni-sierung der Bemühungen im Bereich der Klimaneutralität kann nur nach Vorliegen eines ersten Entwurfs der DVGW-Handreichung zum Thema erfolgen und stellt somit einen Arbeitsauftrag des DVGW PK Klimaneutralität dar.
Forschungsbericht W 202202 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Ein nachhaltiges Asset Management ist für alle
Wasserversorger das Handlungsgerüst zur Bewältigung der komplexen Aufgaben in Bezug auf alternde
Infrastrukturen und sich verändernde Rahmenbedingungen (Demographie, Klimawandel u.a.) in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten. Für den substanzorientierten Werterhalt der
Infrastruktur bedarf es moderner Methoden und Technologien, wobei der Digitalisierung für das
Asset Management eine tragende Rolle zukommt. Es sind am Markt viele verschiedene
Werkzeuge und digitale Tools verfügbar, die für Anlagen in der Wassergewinnung,
-aufbereitung und im Verteilungsnetz bereits Anwendung finden oder es zukünftig könnten. Aufgabe dieses
Projektes DVGW-Forschungsbericht W 202202 war es, einerseits Transparenz über bestehende digitale Tools im Asset
Management der Wasserversorgung zu schaffen, andererseits die damit verbundenen
Nutzungspotenziale zu ermitteln.
Dieses Vorhaben hat die Perspektive zukünftiger
Herausforderungen mit der Praxisperspektive verbunden. Es erfolgte die interaktive Erarbeitung von
möglichen Zielen für den Einsatz digitaler Tools im Asset Management und darauf aufbauend
eine Marktrecherche zu bereits am deutschen Markt verfügbarer Tools. Diese Übersicht stellt
ausgewählte Tools strukturiert nach den Hauptprozessen im Technischen Anlagenmanagement
(TAM) als Teil des Asset Management dar (sog. Tool-Landkarte). In Kurzsteckbriefen
werden den Hauptprozessen zugeordnete Aufgaben mit den hierfür zur Verfügung stehenden Tools mit
ihren wichtigen Merkmalen dokumentiert. Im Rahmen des Projektes wurden auch Hemmnisse
für den bisher teils noch geringen Einsatz digitaler Werkzeuge erarbeitet und
sind in diesem Bericht als Herausforderungen mit dokumentiert. Es erfolgte auch ein Abgleich mit
Entwicklungen in den Niederlanden. Der Bericht schließt mit einer Einschätzung über die
zukünftig zu erwartenden Handlungsstränge im Asset Management in der Wasserversorgung.
Forschungsbericht W 202125 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die seit einigen Jahren in Deutschland beobachtete
Ausweitung des Anbaus von landwirtschaftlichen Kulturen mit Bewässerungsbedarf
in Kombination mit zunehmenden sommerlichen Trockenperioden lässt einen
steigenden Bedarf von Wasser zur Bewässerung und damit, zumindest in einigen
Regionen, eine zunehmende Konkurrenz um die begrenzte Ressource Wasser zwischen
der öffentlichen Wasserversorgung und der Landwirtschaft erwarten.
Ziel des vorliegenden Projektes war es, konkrete
Ansatzpunkte und Verfahren zum Management von Nutzungskonflikten, um die
Ressource Grundwasser in Regionen mit Bewässerung auf der Ebene eines einzelnen
Einzugsgebiets zu erarbeiten.
Dafür wurde relevante Literatur im Hinblick auf die
Fragestellung ausgewertet und Interviews mit verschiedenen Experten und
Akteuren geführt. Unter anderem wurden zwei Beispiele für Verbände näher
betrachtet, die schon seit vielen Jahren eine großflächige Bewässerung in ihren
Gebieten ermöglichen und dabei eine nachhaltige Nutzung von
Grundwasserressourcen anstreben. Eine dieser Beispielregionen liegt in
Niedersachsen, eine weitere in Rheinland-Pfalz. Sowohl deren Organisation und
Entwicklung als auch die Vorgehensweise und die Randbedingungen wurden
erläutert.
Basierend auf den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche
und den Experteninterviews wurde ein Konzeptpapier zum erfolgreichen Konfliktmanagement
erarbeitet, in dem die erforderlichen Voraussetzungen, aber auch die
Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Akteure (Landwirtschaft,
Genehmigungsbehörden, Wasserversorger) zusammengestellt sind. Dies soll als
Hilfestellung dienen, um in betroffenen Regionen fallspezifische Lösungen
erarbeiten zu können.
Forschungsbericht W 202014 02/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
COVID-19 erkrankte Personen scheiden das SARS-CoV-2-Virus
mit dem Kot aus. Seitdem dies bekannt ist, steht die Befürchtung im Raum, dass
SARS-CoV-2 über den Abwasserpfad in die aquatische Umwelt und damit auch in zur
Trinkwassergewinnung genutzte Wässer eingetragen wird. Basierend auf
theoretischen Betrachtungen ist die Verbreitung von SARS-CoV-2 über das Trinkwasser
als äußerst unwahrscheinlich einzustufen. Bislang sind aber kaum reale
Messdaten über das Vorkommen von SARS-CoV-2 in Rohwässern sowie dem Verhalten
von behüllten Viren bei der Wasseraufbereitung verfügbar. Um diese
Wissenslücken zu schließen und die theoretischen Erkenntnisse abzusichern,
wurden im Rahmen dieses Vorhabens entsprechende Untersuchungen durchgeführt und
in dem Forschungsbericht W 202014 festgehalten.
Forschungsbericht W 202003 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Im Forschungsprojekt W 202003 wurde eine auf die Wirkung
bezogene Bewertung von Prozessen der Trinkwasseraufbereitung entwickelt.
Hierfür wurden die Wirkungsbezogene Analytik, eine Kombination aus
Fraktionierung mittels Hochleistungsdünnschichtchromatographie und Bioassay
(HPTLC/WBA), eingesetzt. Wesentliches Projektziel war es, die notwendigen Verfahren
und Konzepte zu erarbeiten, damit die Bewertung von einzelnen oder auch
kombinierten Aufbereitungsprozessen durchgeführt werden kann. Es wurde die
bereits im Vorgängerprojekt WBA-BeReit eingesetzte Laborversuchsanlage zur
kontinuierlichen Ozonung mit anschließender Langsamsandfiltration (KOLa)
modifiziert und um die Aufbereitungs-prozesse Aktivkohlefiltration, Advanced
Oxidation Processes (AOPs) und Chlorungs-Desinfektion erweitert.
Die Weiterentwicklung der verwendeten Anreicherungsmethoden
zeigte aussichtsreiche Ergebnisse, damit durch zukünftige Methoden das
anreicherbare Substanzspektrum um hochpolare und ionische Substanzen erweitert
werden kann. Die in WBA-BeReit getestete Vakuumkonzentration wurde um einen
Schritt zur Matrixabtrennung und Anreicherung, der sog.
„Salz-Lösungsmittel-Extraktion“ (SLE), erweitert, um die aufkonzentrierte
Salzmatrix abzutrennen und die Analyten auf das erforderliche Niveau
anzureichern. Trotz aktueller Einschränkungen bei der Reproduzierbarkeit konnte
in Kleinversuchen die prinzipielle Eignung des neuen Verfahrens anhand
organischer Anionen gezeigt werden. Im Gegensatz zur reinen Vakuumkonzentration
waren die SLE-Extrakte mit der WBA kompatibel
GW 130 Entwurf Arbeitsblatt 11/2023
Preis ab:
79,28 €*
Dieses Arbeitsblatt GW 130 Entwurf gilt für die Einführung und die Anwendung eines Qualitätssicherungssystems bei Geschäftsprozessen zur Erhebung, Erfassung, Aktualisierung und Nutzung von geographischen Informationen sowie den zugehörigen Sachdaten zu Leitungen und Anlagen der Gas- und Wasserverteilung wie auch der Rohrfernleitungen. Im Wesentlichen sind die Ausführungen für die digitale Netzdokumentation formuliert. Für den Fall der analogen Dokumentation sind die Festlegungen und Systematiken gleichermaßen anzuwenden.Die DVGW GW 130 versteht sich als Bestandteil eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems, wie z. B. DIN EN ISO 9000. In erster Linie liegt der Schwerpunkt auf der Definition unternehmensspezifischer Kennzahlen für die Netzdokumentation, dem regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich sowie dem Ableiten von Maßnahmen zur Verbesserung von Daten und Prozessabläufen.
DVGW-Information Wasser Nr. 92 07/2023
Preis ab:
110,68 €*
Die DVGW-Information Wasser Nr. 92 soll vorwiegend kleinen Wasserversorgungsunternehmen eine praxisorientierte Hilfestellung bei der Erstellung eines Handbuchs zur Organisation des technischen Betriebs geben. Angaben zu kaufmännischen Prozessen beschränken sich auf Tätigkeitsfelder, die unmittelbare Schnittstellen zum technischen Bereich haben (z.B. Zählerwesen, Beschaffung/Materialwirtschaft und Investitionsplanung). Diese DVGW-Information Wasser Nr. 92 gibt Empfehlungen für Aufbau und Gliederung des Handbuchs, für die Einrichtung eines Anweisungssystems und beinhaltet Checklisten und Formulierungsvorschläge für Musterschreiben. Darüber hinaus liefert sie auch Hinweise zur redaktionellen Bearbeitung und zum Änderungsdienst.