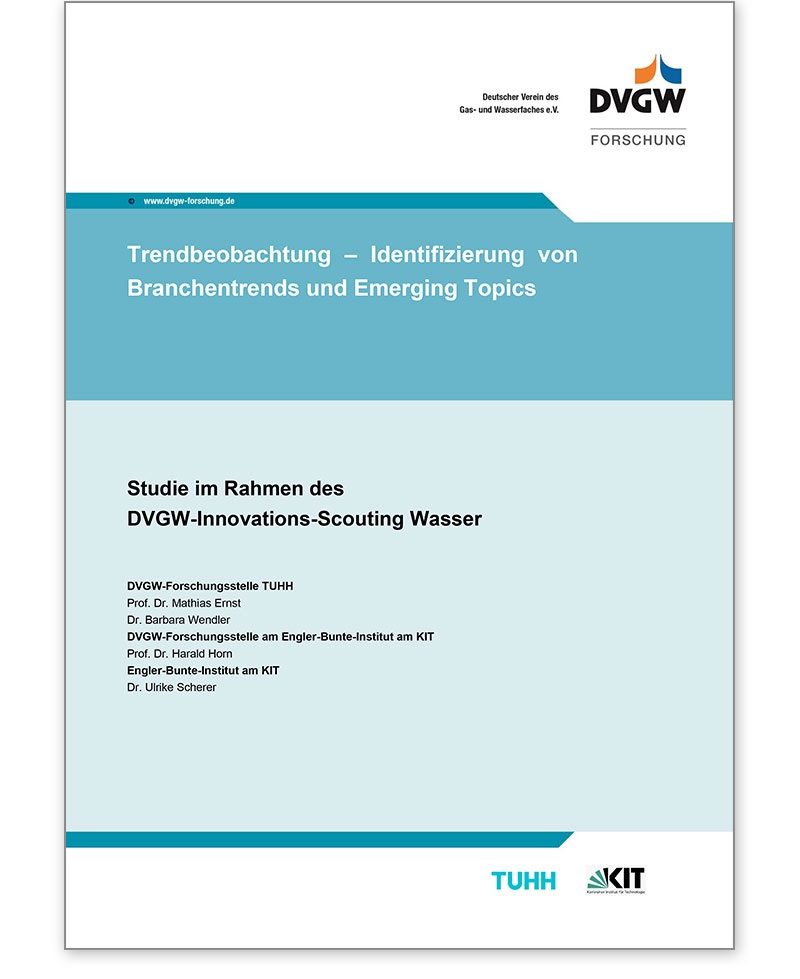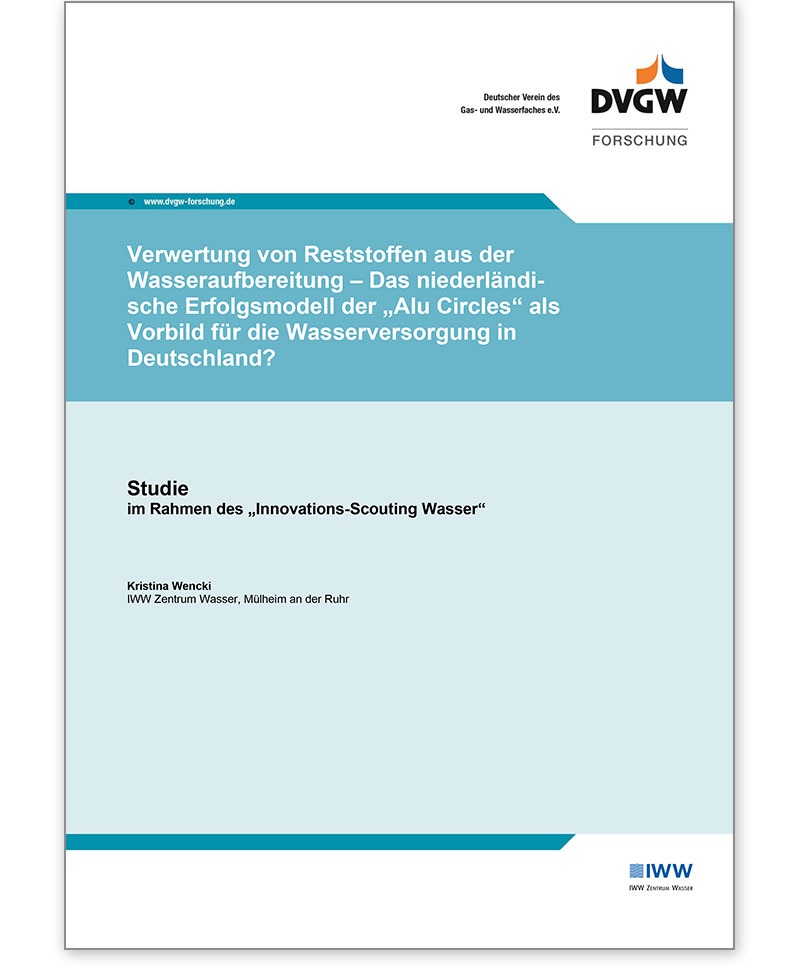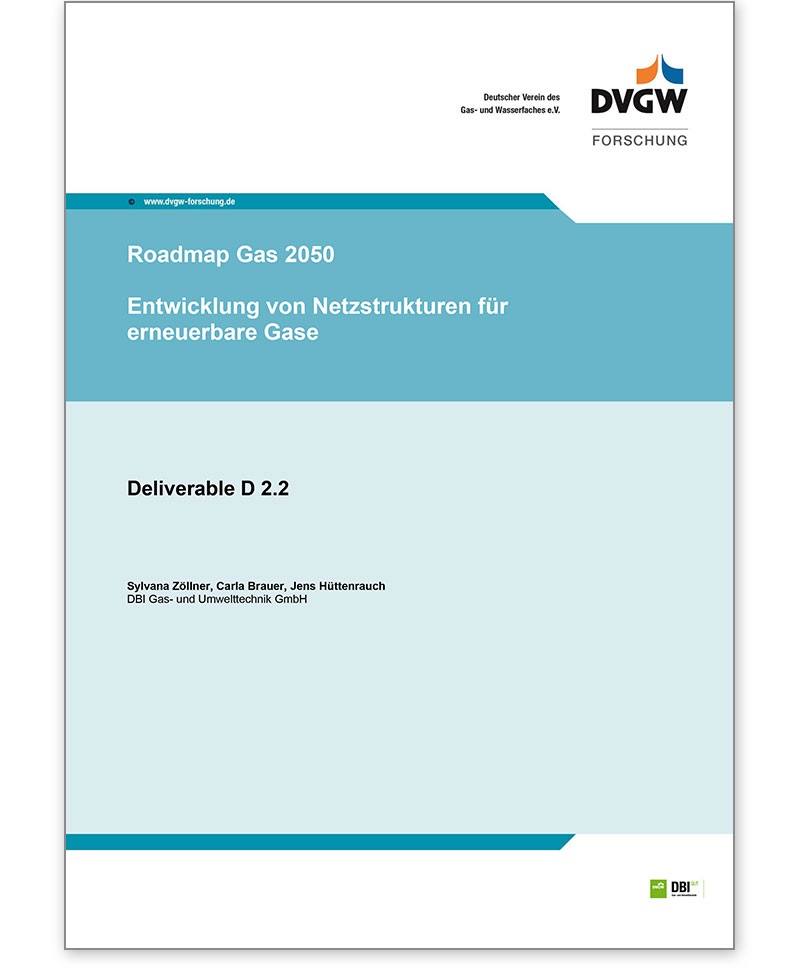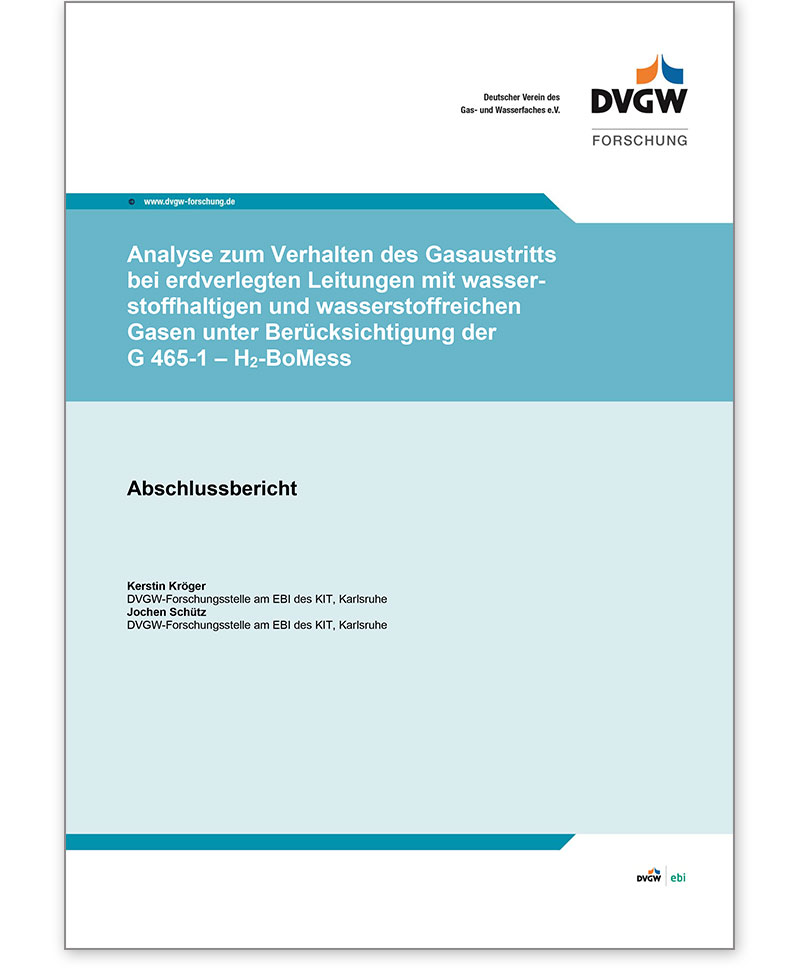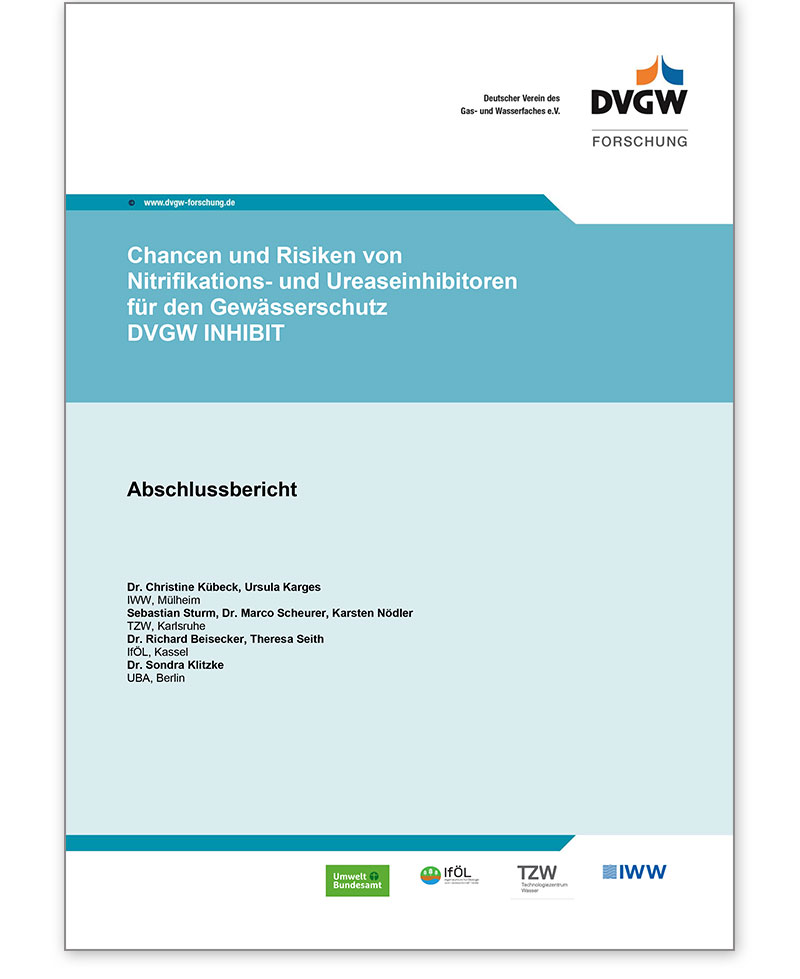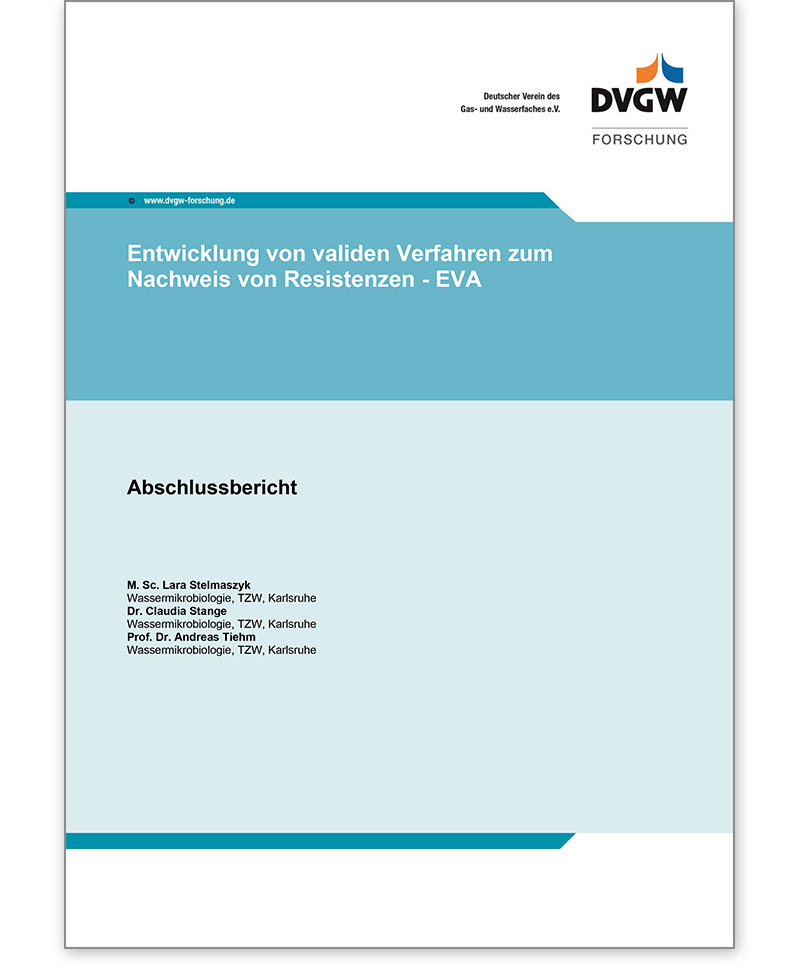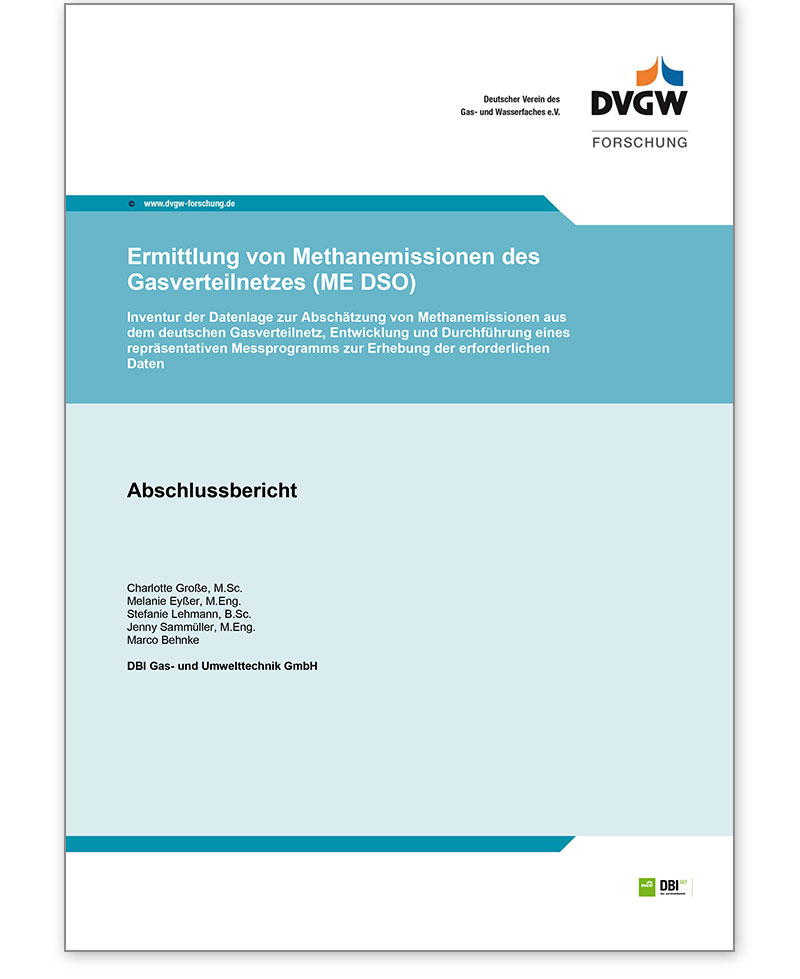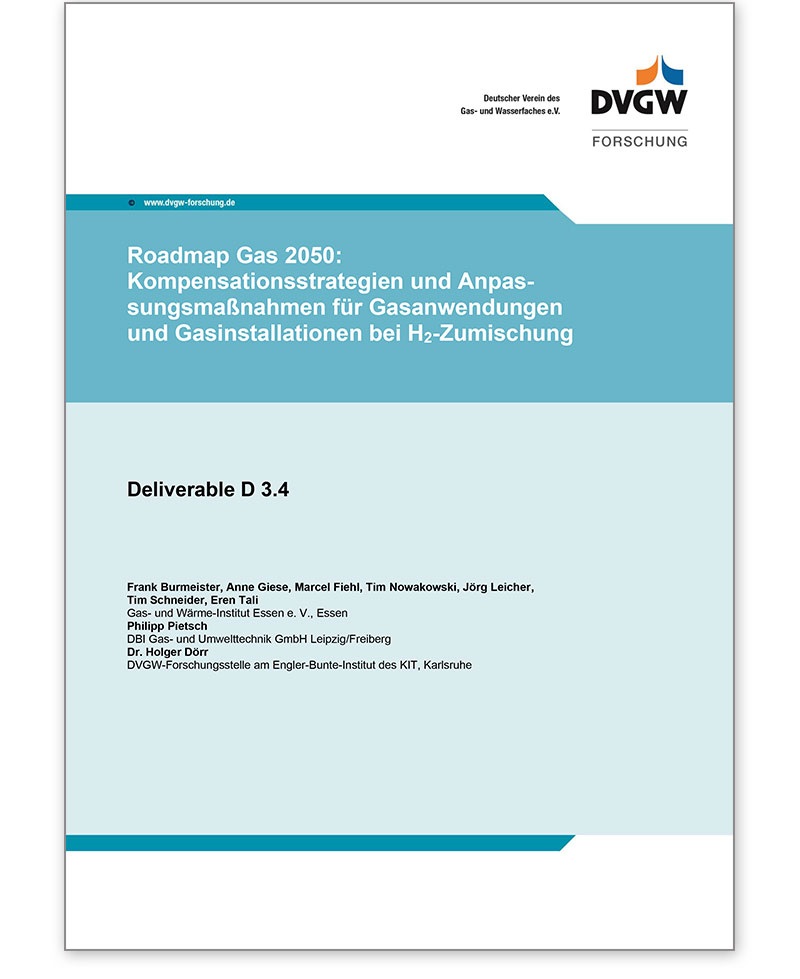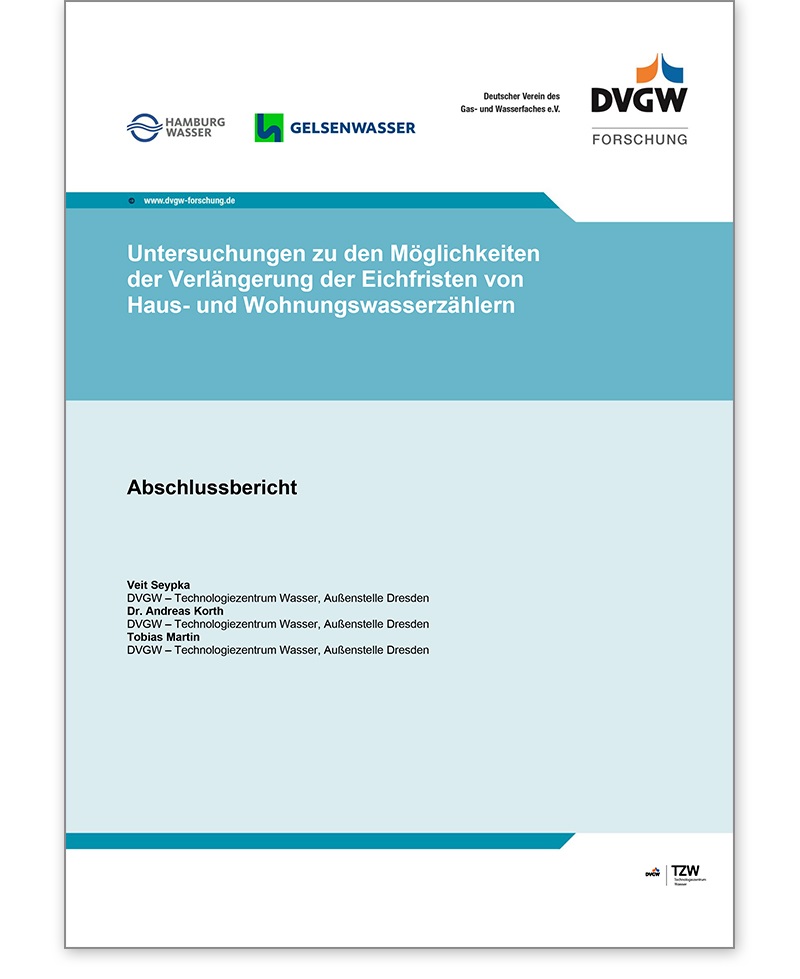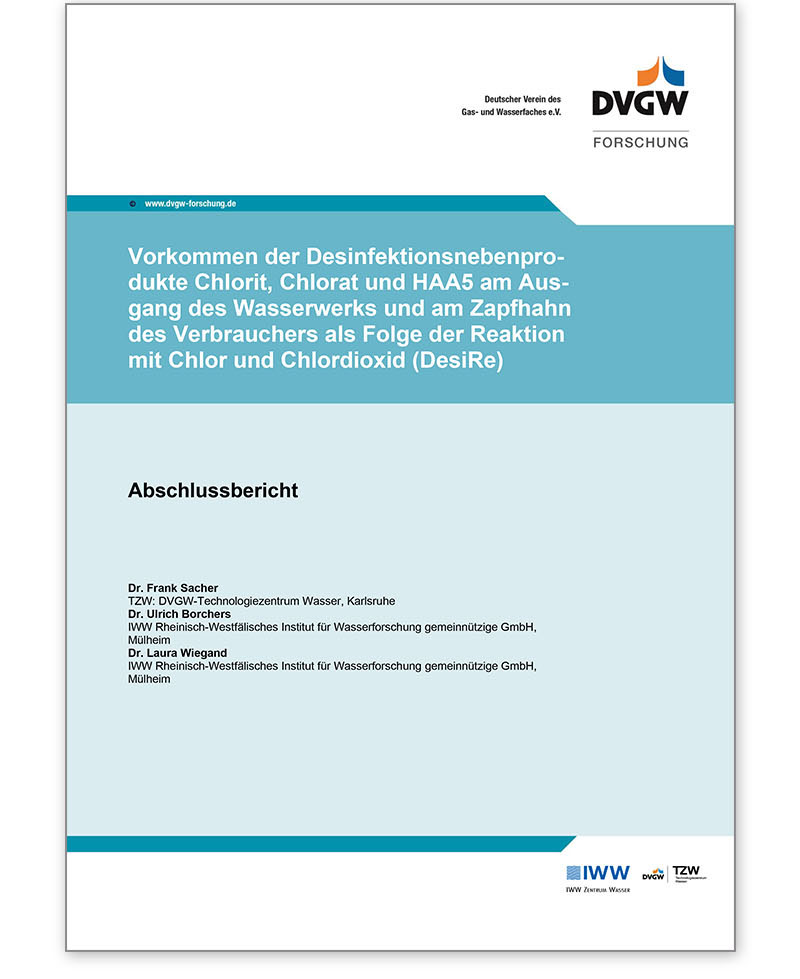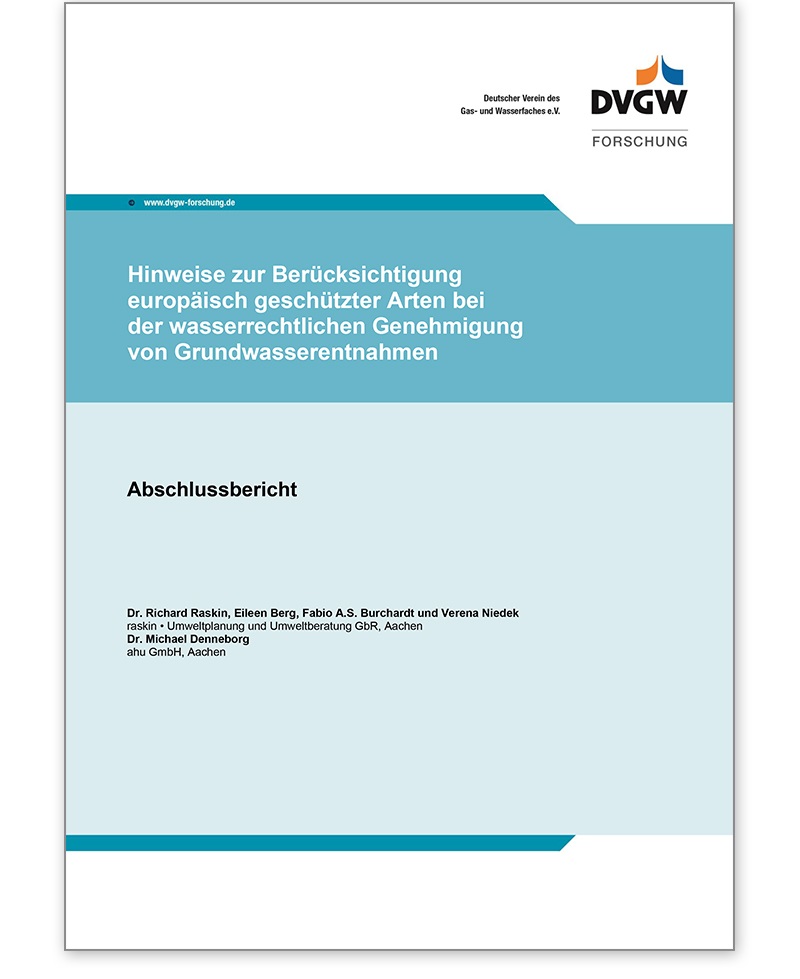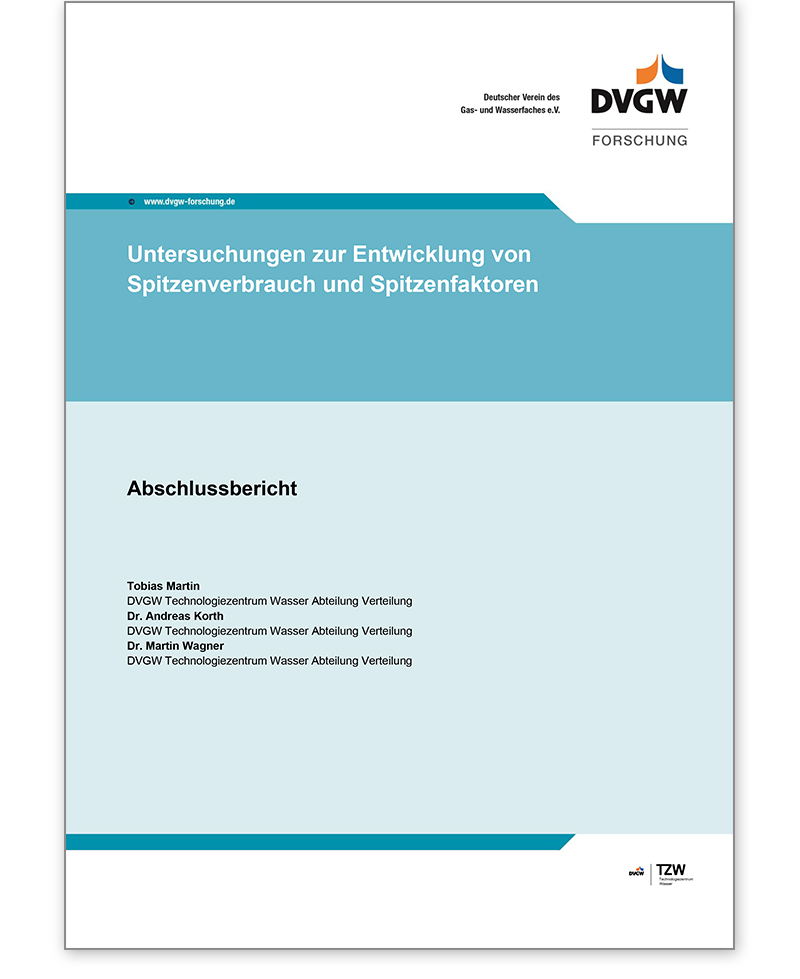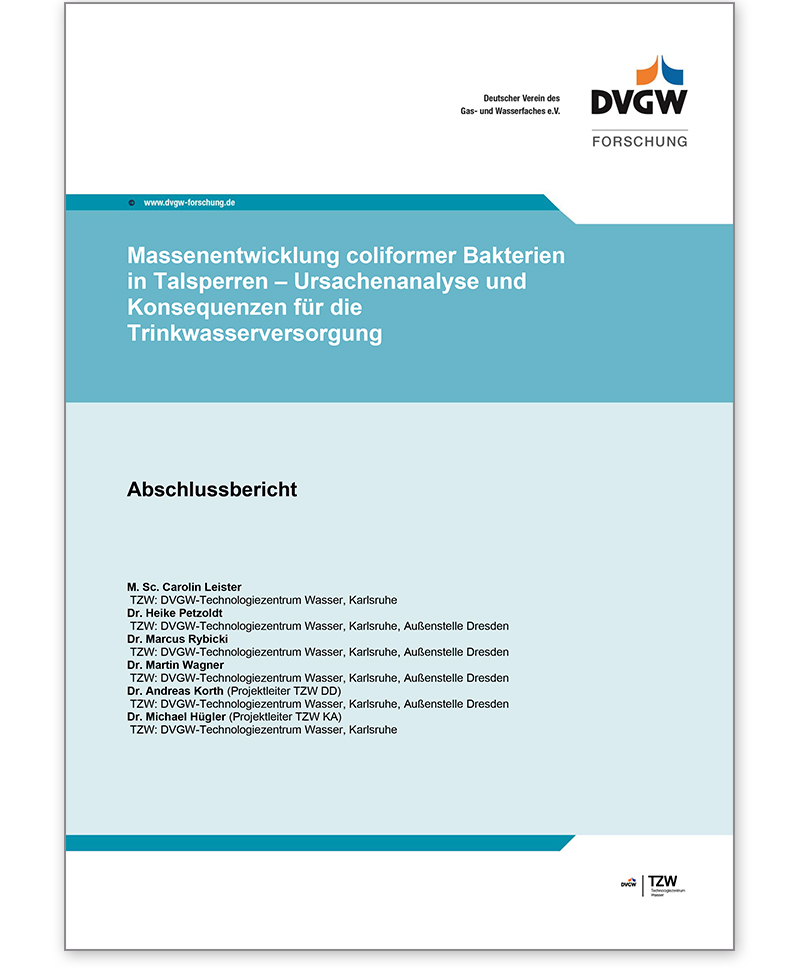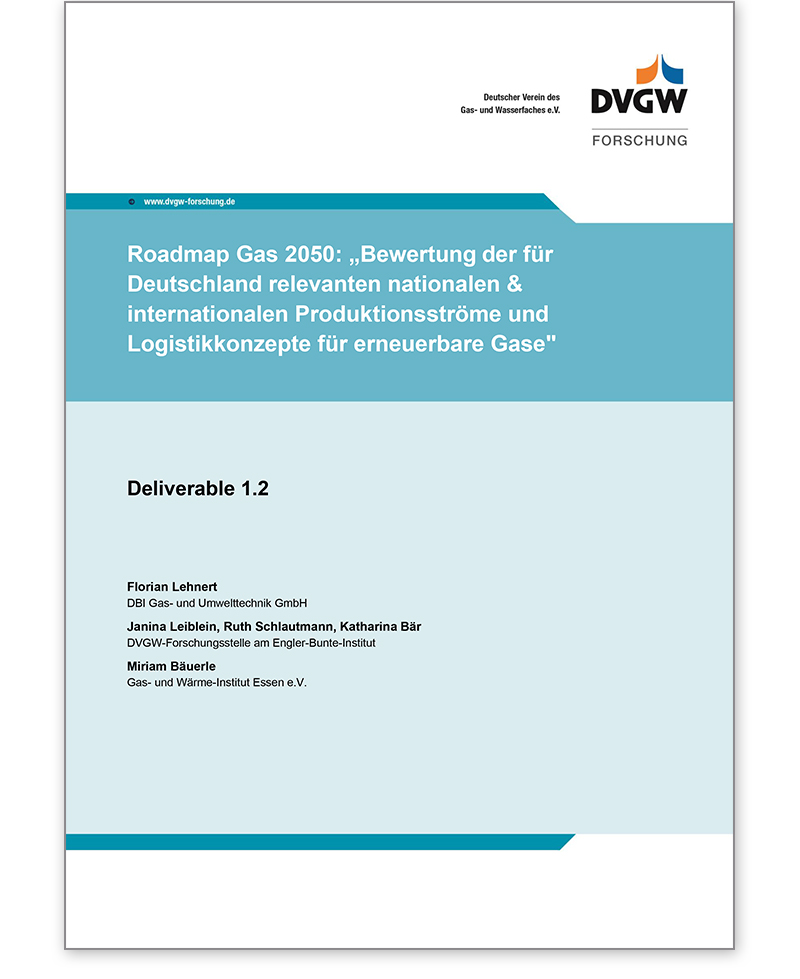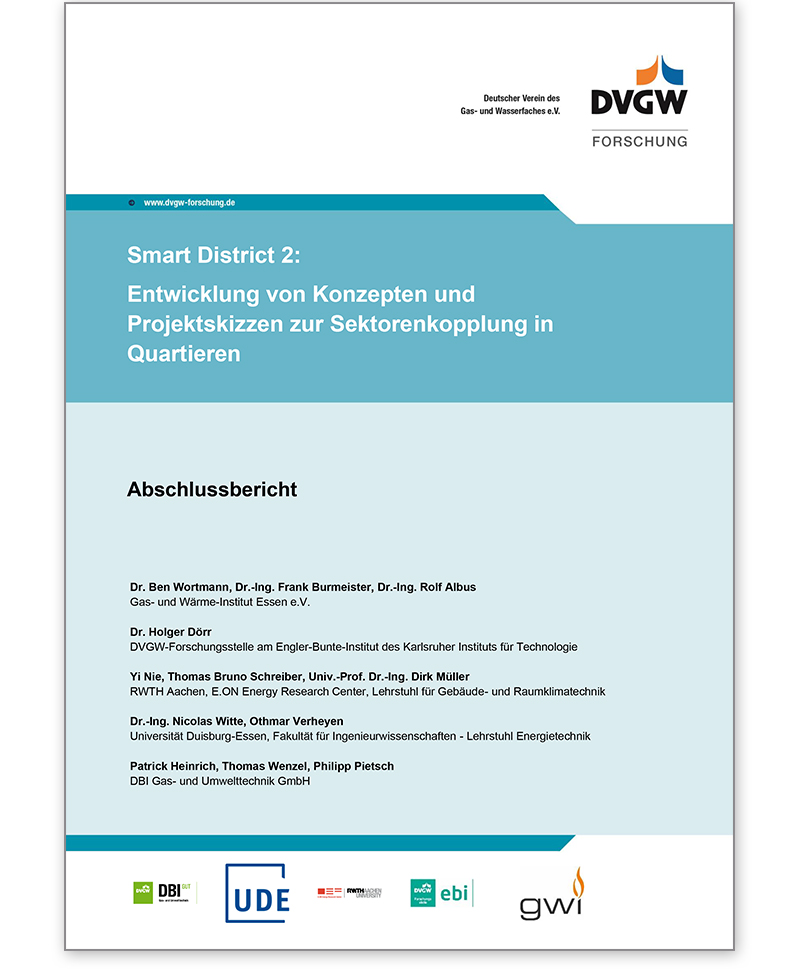DVGW-Forschungsberichte
Forschung und Innovation für eine gesicherte Gas- und Wasserversorgung
Der DVGW unterstützt seit vielen Jahren die Energiebranche auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ziel ist es, das Energiewendepotenzial klimaneutraler Gase zu nutzen, ihre Erzeugung und Verwendung zu fördern und den Wert der Gasinfrastrukturen dauerhaft zu erhalten. Für die Wasserversorgung entwickelt der DVGW zukunftsweisende Ansätze und innovative Lösungskonzepte für eine qualitativ und quantitativ gesicherte sowie klimaresiliente Versorgung. Die hier vorhandenen Forschungsberichte sind Ergebnisse der DVGW-Forschungsprojekte und Vorläufer der technischen Regelsetzung.
Forschungsberichte Gas
Forschungsberichte Wasser
Forschungsberichte Gas/Wasser
Forschungsbericht W 201826 Studie Sensoren 04/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Das Ziel des Projektes SCOUT besteht darin, für eine breitere
Gruppe von Wasserversorgern konkrete technische Lösungsmöglichkeiten zu
spezifischen Einzelthemen zu identifizieren. Zielgruppe sind innovative
Wasserversorgungsunternehmen, die für konkret anstehende Aufgabenstellungen
moderne Lösungen suchen.
Die vorliegende Studie befasst sich mit Sensortechnologien
zur Qualitätsüberwachung in der Wasserversorgung. Diese enthält einen aktuellen
Überblick aktueller Entwicklungen einschließlich einer Einschätzung des
technischen Reifegrades. Die Studie untergliedert sich in die Bereiche
online-Sensoren und Schnelltests für mikrobiologische und
chemisch-physikalische Parameter. Hierzu wurden aktuelle Produktentwicklungen
im Sensorbereich diskutiert und nach der TRL-Kategorisierung
(Technology-Readiness-Level) bewertet. Angrenzende Anwendungsbereiche wurden
ebenfalls berücksichtigt.
Forschungsbericht W 201826 Studie Trendbeobachtung 04/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Das Ziel des DVGW-Innovations-Scouting Wasser besteht darin,
für eine breitere Gruppe von Wasserversorgern konkrete technische Lösungsmöglichkeiten
zu spezifischen Einzelthemen zu identifizieren. Zielgruppe sind innovative
Wasserversorgungsunternehmen, die für konkret anstehende Aufgabenstellungen
moderne Lösungen suchen.
Ziel der vorliegenden Studie war es, aktuelle internationale
Aktivitäten in der Wasserforschung zu beobachten und auszuwerten, um einen
Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich Trinkwasser zu erhalten.
Dabei waren Forschungsthemen zu erfassen, die sich aktuell stark entwickeln.
Zusätzlich wurden Fragestellungen identifiziert, die in der Forschung bisher
unterrepräsentiert sind.
Forschungsbericht W 201826 Studie Verwertung 04/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Das Ziel des Projektes SCOUT besteht darin, für eine
breitere Gruppe von Wasserversorgern konkrete technische Lösungsmöglichkeiten
zu spezifischen Einzelthemen zu identifizieren. Zielgruppe sind innovative
Wasserversorgungsunternehmen, die für konkret anstehende Aufgabenstellungen
moderne Lösungen suchen.
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Verwertung von
Reststoffen aus der Wasseraufbereitung. Die Verwertung wird in Deutschland
maßgeblich durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie das
Bodenschutzgesetz bestimmt. Dementsprechend wird eine Umstellung der
Deponierung auf Verwertung gefordert, was entsprechende Handlungsmaßnahmen
seitens der Wasserversorgungsunternehmen erfordert. Aus Sicht der
Wasserversorger besteht insbesondere ein Bedarf für Lösungen mit Umgang aus
den Rückständen der Flockung. Hierfür bestehen bereits Lösungsansätze in den
Niederlanden. Diese werden in der vorliegen-den Studie betrachtet und Handlungsoptionen
für Deutschland diskutiert.
Forschungsbericht G 201824 D 2.2 06/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Das Gasversorgungssystem kann auch in der Zukunft dem
gesamten Energiesystem bei der Erreichung der Klimaziele dienen. Zum Einen
eignet es sich kurz- bis mittelfristig als Brückentechnologie für den Übergang
von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern und durch die zunehmende
Bereitstellung von klimaneutralen Gasen (Dekarbonisierung der Gasversorgung)
mittels Nutzung der Potenziale erneuerbarer Gase (Biomethan und SNG - Methan
aus vergaster, ligninreicher Biomasse). Zum Anderen bietet Power-to-Gas
langfristig die Möglichkeit, große Mengen an erneuerbaren Strom durch
Umwandlung in EE-Wasserstoff oder EE-Methan in die Gasnetze zu integrieren, zu
speichern und die Energie aus Erneuerbaren Energien bedarfsgerecht
sektorenübergreifend zur Verfügung zu stellen.
Während die Fernleitungsnetzbetreiber auf zwei getrennte
Gasnetze setzen: ein Methan- und ein Wasserstoffsystem, reichen die Planungen
der Verteilnetzbetreiber, z. B. in H2vorOrt, von Methansystemen mit
Wasserstoffzumischung über Biomethannetze bis hin zu reinen Wasserstoffnetzen
– u.a. je nach regionaler Verfügbarkeit erneuerbarer Gase und Planungen
vorgelagerter Netzbetreiber.
Ziel dieses DVGW-Forschungsberichtes G 201824 ist die Identifizierung von
Regionen, in denen die Integration von erneuerbaren Gasen (EE-Wasserstoff,
EE-Methan, Biomethan und SNG) in den Verteilnetzen aufgrund von vorhandener
Nachfrage, Erzeugung und Infrastruktur (Verfügbarkeit) für erneuerbare Gase,
insbesondere Wasserstoff frühzeitig erfolgen sollte. Diese Regionen werden im
Folgenden als Regionen mit Standortvorteilen für die Implementierung von
Verteilnetzen für erneuerbare Gase (kurz: Regionen für EE-Gase) bezeichnet.
Darüber hinaus erfolgt die Ableitung der zu bevorzugenden Art der
EE-Gas-Implementierung: Eine Umstellung der öffentlichen Gasversorgung (der
bisher auf Erdgas optimierten Gasnetze) oder ein Neubau von Ver-teilnetzen (für
z.B. Biomethan oder Wasserstoff). Darüber hinaus sind Zumischungen von
erneuerbaren Gasen in den Grenzen des DVGW-Regelwerks nahezu in ganz
Deutschland möglich – das liegt allerdings nicht im Fokus dieses Deliverables.
Die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung wird durch
die zeitliche Auflösung mittels Stützjahre 2030, 2040 und 2050 abgebildet. Die
Basis bilden öffentlich verfügbare Daten sowie vorliegenden Projektergebnissen
des DVGW-Projekts Roadmap Gas 2050.
Forschungsbericht G 202022 03/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Der DVGW-Forschungsbericht
G 202022 befasst sich mit sicherheitstechnischen Aspekten von Wasserstoff in
erdverlegten Leitungen. Im DVGW-Forschungsvorhaben H2-BoMess sollte die Wissenslücke bezüglich der Ausbreitungscharakteristik
von Wasserstoff im Boden und die sich entwickelnde Austrittsfläche geschlossen
werden. Hierzu wurden Gaskonzentrationsmessgeräte zur oberirdischen Überprüfung
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 465-1 eingesetzt. Damit konnte auch die Eignung
dieser Messgeräte zur oberirdischen Detektion von Wasserstoff geprüft werden.
Dieses Forschungsvorhaben sollte einen Erkenntnisgewinn zur
Ausbreitungscharakteristik von Wasserstoff im Boden und dessen Austritt an der
Oberfläche liefern. Des Weiteren wurde die oberirdische Detektion von
Wasserstoffleckagen mit am Markt verfügbaren Messgeräten untersucht.
Um in den nächsten Jahren eine signifikante Einspeisung von
Wasserstoff aus klimaneutralen Quellen zu ermöglichen, ist es erklärter Wille
der Gaswirtschaft, die Wasserstoffverträglichkeit der gesamten Gasinfrastruktur
deutlich zu erhöhen. Dabei werden sowohl die Zumischung von Wasserstoff zu
Erdgas oder Biogas als auch der Betrieb von Wasserstoffnetzen (> 98 Vol.-%)
in Betracht gezogen. Der Sicherheitsaspekt bei einem möglichen Gasaustritt
durch eine Leckage in den erdverlegten wasserstoffführenden Leitungen muss
hierbei auch betrachtet werden. Während es bereits Erkenntnisse zum
Ausbreitungsverhalten von methanhaltigen Gasen im Boden und zur entstehenden
Austrittsfläche gibt, sind derzeit keine entsprechenden Forschungsergebnisse zu
wasserstoffhaltigen Gasen bekannt.
Ein zentrales Sicherheitselement für den Integritätsnachweis
von Gasverteilnetzen ist die Rohrnetzüberprüfung. Die Durchführung der
oberirdischen Überprüfung und die Anforderungen an Messverfahren sind in den
DVGW-Arbeitsblättern G 465-1 und G 468-1 sowie in verschiedenen zugeordneten
Merkblättern beschrieben.
Auch bei wasserstoffführenden erdverlegten Leitungen ist
sicherzustellen, dass der Gasaustritt mithilfe einer oberirdischen
Detektionstechnik ermittelt werden kann. Die hierfür einzusetzenden Messgeräte
müssen empfindlich gegenüber Wasserstoff sein. Wasserstoff detektierende
Messverfahren sollten das derzeitig erreichbare Sicherheitsniveau erreichen.
Das Projekt untergliederte sich hierbei in vier Arbeitspakete.
Im Arbeitspaket 1 (AP 1) wurden die derzeitigen Anforderungen des
DVGW-Regelwerks zur Rohrnetzüberprüfung zusammen-gefasst und hinsichtlich der
Detektion von Wasserstoff geprüft. Dies umfasste die DVGW-Arbeitsblätter G
465-1 „Überprüfung von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 16 bar“, G
468-1 „Qualifikationskriterien für Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen“ und die
zugehörigen Merkblätter. Hieraus wurden spezifische Anforderungen an Messgeräte
zur oberirdischen Wasserstoffdetektion abgeleitet. Im zweiten Arbeitspaket (AP
2) wurde eine Analyse von prinzipiell geeigneten und kommerziell verfügbaren
Messprinzipien zur Detektion von Wasserstoff im Rahmen der oberirdischen
Leitungsüberprüfung durchgeführt. Hier fand auch eine Beschreibung von bereits
vorhandenen Messgeräten statt. Im Rahmen des dritten Arbeitspakets (AP 3)
wurden Messkampagnen zur praktischen Untersuchung bereits vorhandener
Wasserstoffdetektionsverfahren durchgeführt. Im Arbeitspaket 4 (AP 4) wurden
die Ergebnisse und Erkenntnisse im vorliegenden Abschlussbericht
zusammengefasst und erste Handlungsempfehlungen erarbeitet.
Forschungsbericht W 201917 04/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Inhalte DVGW-Forschungsbericht W 201917:
Mit der Novellierung der Düngeverordnung wird der
Einsatz stabilisierter Harnstoffdünger als übergeordnete Maßnahme für einen
effizienten Düngemitteleinsatz erstmals im gesetzlichen Rahmen festgeschrieben.
Nach § 6 Abs. 2 DüV darf Harnstoff als Düngemittel ab dem 01.02.2020 nur noch
ausgebracht werden, soweit ihm ein Ureasehemmstoff zugegeben ist oder dieser
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 4 Std. nach der Aufbringung eingearbeitet
wird. Da Harnstoff nach wie vor der preisgünstigste mineralische
Stickstoffdünger ist, ist davon auszugehen, dass dadurch die Anwendung von
Ureasehemmstoffen in Mineraldüngern spürbar zugenommen hat.
In dem Forschungsvorhaben INHIBIT wurde das Verhalten dieser
in der Landwirtschaft eingesetzten Düngemittelzusatzstoffe in der Umwelt näher
betrachten. Im Hinblick auf den Grundwasserschutz und die Belange der
Wasserversorgungswirtschaft war es ein Untersuchungsziel, die Chancen für eine
Verminderung der Nitrateinträge in das Grundwasser, aber auch Risiken durch den
Eintrag dieser Wirkstoffe für den Gewässerschutz, darzustellen. Dabei standen
vorrangig die möglichen Eintragspfade über die (ungesättigte) Bodenzone und die
(gesättigte) Uferfiltration im Fokus.
Der Einsatz dieser Wirkstoffe in der Landwirtschaft kann
potenziell zu einem flächenhaften Eintrag dieser Stoffe ins Grund- und
Oberflächengewässer führen. So ist das Umweltverhalten der eingesetzten
Wirkstoffe einerseits bislang nur unzureichend bis nicht dokumentiert. Ge-rade
bei den stärker polaren und wasserlöslichen Vertretern dieser Gruppen ist – bei
ausreichender Persistenz und durch ihre potenzielle Mobilität im
Wasserkreislauf – eine Trinkwasserrelevanz nicht auszuschließen. Bisherige
Nachweise einzelner Wirkstoffe auch in deutschen Oberflächengewässern und im
Grundwasser unterstreichen dies. Mögliche Metaboliten sind (noch)
nicht bekannt bzw. es ist zu erwarten, dass diese analytisch nicht oder nur
schwer erfassbar sind. Die bisher vorliegenden wenigen Studien weisen auch hier
auf eine mögliche Belastungssituation hin. Andererseits zeigen Studien zur
Düngewirksamkeit von Nitrifikations- und Ureasehemmern und der Verminderung der
Nitratauswaschung eine große Spannbreite von keinen messbaren Wirkungen bis zu
einer Minderung der Stickstoffverluste von bis zu 50% auf. Gesichert dagegen
ist allein die Verminderung der gasförmigen N-Verluste bei der Anwendung von
Harnstoff und Gülle beim Einsatz von Nitrifikations- und Ureasehemmern.
In dem Forschungsvorhaben wird das Verhalten dieser in der
Landwirtschaft perspektiv zu-nehmend eingesetzten und teils neuartigen Stoffen
in der Umwelt näher betrachtet, um die Risiken im Hinblick auf den
Grundwasserschutz und auf die Belange der Wasserversorgungs-wirtschaft abzuschätzen.
Neben der Schaffung einer einheitlichen und konsistenten Datenbasis zur
Beschreibung der Ausgangslage und des Wissensstandes anhand von verfügbarer
Literatur, wurden die methodischen Grundlagen zur Untersuchung der Stoffe in
Bodeneluaten weiterentwickelt. Ziel war es hierbei, eine erste Bewertung des
Verlagerungsverhaltens der Wirkstoffe zu ermöglichen. Die im Forschungsvorhaben
durchgeführten Experimente auf unterschiedlichen Größenskalen bilden zudem eine
wichtige Grundlage, um Wissenslücken zum Umweltverhalten der Wirkstoffe, die
sich aus der Literaturrecherche ergeben haben, zu schließen und eine
weiterführende Datenbasis zu erarbeiten.
Darüber hinaus erwies sich der rechtliche Rahmen (Zulassung
und Zuständigkeiten) als wesentlicher Baustein bei der wasserwirtschaftlichen
Einordnung der Inhibitoren. So ist derzeit das EU-weite Zulassungsverfahren im
Umbruch. Mit Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung sollen harmonisierte
Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Kennzeichnung erreicht werden. In
diesem Zusammenhang wurde durch das UBA 2021 eine „Fachtagung zur Umweltbewertung
von Düngemittelzusatzstoffen“ veranstaltet. Wesentliche Schwerpunkte der
Fachtagung waren: Gefährdungspotenziale, Risikoabschätzung,
Regulierungsmöglichkeiten und Überwachungskonzepte. Wichtige Ergebnisse dazu
wurden von der Fachtagung übernommen und im Kontext des Forschungsvorhabens
diskutiert.
Eine generalisierte Empfehlung für oder gegen den Einsatz
von Stickstoffinhibitoren in Verbindung mit Düngeanwendungen ist nach dem
Ergebnis dieser DVGW-Forschungsberichtes W 201830 weder auf Grundlage der im
Projekt durchgeführten Untersuchungen noch auf Basis der Erkenntnisse aus der
Literaturrecherche uneingeschränkt möglich. Die Ergebnisse zeigen, dass
mögliche Risiken und Chancen, die sich aus ihrer Nutzung für die
Wasserversorgung ergeben können, wirkstoffspezifisch und in Abhängigkeit von
den Bedingungen vor Ort abgewogen werden müssen.
Forschungsbericht W 201830 05/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Im Rahmen des Projektes des DVGW-Forschungsberichts W 210830
wurde die Nachweismethodik für Antibiotikaresistenzen weiterentwickelt. Die
derzeitigen Kulturverfahren aus dem klinischen Bereich erfassen Bakterien, die
unter Nährstoffreichen Bedingungen wachsen. Es konnte erfolgreich ein
Kulturverfahren zur Erfassung von antibiotikaresistenten Umweltbakterien
etabliert werden. Mit diesem Verfahren können Cephalosporin-resistente und
Carbapenemase-bildende oligotrophe Bakterien in Wasserproben erfasst werden.
Diese Resistenzen sind im klinischen Bereich weltweit von hoher Relevanz, da
sie die Wirksamkeit der Reserve-Antibiotika einschränken. Durch die
weiterführende Untersuchung der gewonnenen Isolate konnten die
Bakteriengattungen identifiziert und die Expression von β-Laktamasen belegt
werden. Auch die PCR-Methodik zum Nachweis von Antibiotikaresistenzgenen wurde
weiterentwickelt. Bei der konventionellen quantitativen PCR (qPCR) werden
bislang 100-300 Basenpaar lange Fragmente der Antibiotikaresistenzgene
nachgewiesen. Im Rahmen des Vorhabens wurde die Methodik der Long Amplicon
(LA)-qPCR weiterentwickelt. Da nur vollständige Gene mit ca. 800-2000
Basenpaaren zur Entwicklung von Resistenzen führen, können somit
falsch-positive Befunde minimiert werden. Insbesondere nach der
Wasseraufbereitung mittels reaktiver Verfahren wie Ozonung oder UV-Behandlung
entstehen kleine Genfragmente. Die Versuche zeigten, dass mittels der LA-qPCR
nach der Behandlung deutlich weniger Gene erfasst werden als mit der
herkömmlichen Methode. Im Projekt wurde auch der Einsatz der Propidium-Monoazid
(PMA)-qPCR zur Erfassung geschädigter Zellen geprüft. Es zeigte sich
allerdings, dass die benötigte PMA-Konzentration und die optimalen
Inkubationsbedingungen zwischen den Umweltbakterien stark variieren und nicht
vereinheitlicht werden können. Daher kann keine Standard-Methode der PMA-qPCR
für die Untersuchung von Umweltproben empfohlen werden.
Mit den zur Verfügung stehenden Methoden wurde das Vorkommen
von antibiotikaresistenten Bakterien und Antibiotikaresistenzgenen im Rohwasser
erfasst sowie das Verhalten von Antibiotikaresistenzen bei der
Trinkwasseraufbereitung mittels naturnaher/ mikrobiologischer Verfahren,
Filtrationsschritten und Desinfektionsverfahren untersucht. Die Untersuchungen
zeigten, dass die Aufbereitung zu einer deutlichen Reduktion der antibiotikaresistenten
Bakterien und Antibiotikaresistenzgene führt. Daher ist eine Gefährdung des
Trinkwassers derzeit nicht zu erwarten, wenn die anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden und das Trinkwasser den gesetzlichen hygienisch-mikrobiologischen
Anforderungen entspricht. Zur Erfassung des aktuellen Ist-Zustandes und der
zeitlichen Entwicklungen sowie für eine abgesicherte Bewertung der Situation
wird die zukünftige Durchführung von Monitoring-Programmen mit den etablierten
Methoden empfohlen.
Eine Verbesserung der Methodik für den Nachweis von
Antibiotikaresistenzen in der Umwelt ist notwendig, um den tatsächlichen Grad
an Belastung sicher erfassen zu können. Mit den verbesserten Verfahren wurde
die Datenbasis in Bezug auf das Vorkommen von Antibiotikaresistenzen im
Rohwasser und ihrem Verhalten bei der Trinkwasseraufbereitung ausgebaut. Die
Untersuchungen erfolgten im Labor sowie in Proben von mehreren
Wasserversorgungsunternehmen, die das Vorhaben aktiv unterstützten.
Forschungsbericht G 201812 02/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Das Forschungsprojekt G 201812 soll die aktuelle mit der erforderlichen Datenlage abgleichen, die für eine transparente, konsistente und ausreichend genaue Abschätzung der Methanemissionen aus dem Gasverteilnetz erforderlich ist. Die erforderliche Datenlage geben die Leitlinien von Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) (8), die EU‑Methanverordnung (4) und das Europäische Komitee für Normung (CEN) (9) vor. An diesen Vorgaben orientiert sich das vorliegende Projekt hinsichtlich der verwendeten Definitionen und Begriffe.Die Ziele des Projektes ME DSO lauten wie folgt: Es sollen aktuelle nationale Emissionsfaktoren (EF) für das deutsche Gasverteilnetz ermittelt werden. Da die EF quellspezifisch sind und auf Messungen basieren, entsprechen sie einem OGMP Level 3. Für fehlende Emissionsraten ist ein geeignetes Messprogramm zu entwickeln und die Durchführung einer zielgerichteten Messkampagne an ausgewählten Assets zu ermöglichen. Hierbei sollen auch Messprotokolle entwickelt werden, welche als Grundlage für zukünftige Messungen dienen können.Der Fokus des Projekts liegt auf erdverlegten Rohrleitungen Versorgungsleitungen (VL) und Netzanschlussleitungen (NAL) sowie Gas‑Druckregel‑ und Messanlagen (GDRMA). Diese Assets wurden bei bisherigen Messungen als Hauptemissionsquellen identifiziert.
Forschungsbericht G 201824 D 3.4 03/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Forschungsbericht G 201824 D 3.4 03/2022 ‑PDF‑Datei‑
Forschungsbericht W 201722 01/2022 -PDF-Datei-
246,10 €*
Forschungsbericht W 201722 01/2022 ‑PDF‑Datei‑
Forschungsbericht W 202121 12/2021 -PDF-Datei-
246,10 €*
Forschungsbericht W 202121 12/2021 ‑PDF‑Datei‑
Forschungsbericht G 201824-D 1.2 06/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
In diesem Bericht G 201824 D
1.2 werden die EE-Gaspotenziale (Biomethan, SNG, EE-CH4, EE-H2) in Europa
(EU-27 + UK) ermittelt und mögliche Transportrouten nach Deutschland
analysiert. Im ersten Schritt werden die europäischen EE-Erzeugungspotenziale
länderspezifisch ermittelt und ein technisch umsetzbarer Markthochlauf
definiert. Unter Berücksichtigung der energiepolitischen Ziele und des
Eigenbedarfs der Erzeugungs- und Transitländer werden dann mögliche
EE-Gas-Exportmengen ausgewiesen.
Die im Rahmen von Roadmap Gas 2050 bereits durchgeführte
technoökonomische Bewertung verschiedener Wasserstoffherstellungsverfahren hat
gezeigt, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in der MENA-Region und der
Transport nach Deutschland eine viel versprechende Alternative darstellt [2].
Die Erzeugungspotenziale in dieser Region übersteigen den erwarteten
europäischen Bedarf um ein Vielfaches. Allerdings fallen höhere
Transport-kosten im Vergleich zur innereuropäischen Erzeugung an und die
politische Lage in der Region lassen hohe Risikoaufschläge bei potenziellen
Investoren erwarten. In diesem Bericht wurde der Import von EE-Methan aus der
MENA-Region mit dem Import von grünem Wasser-stoff anhand einer
technoökonomischen Analyse verglichen.