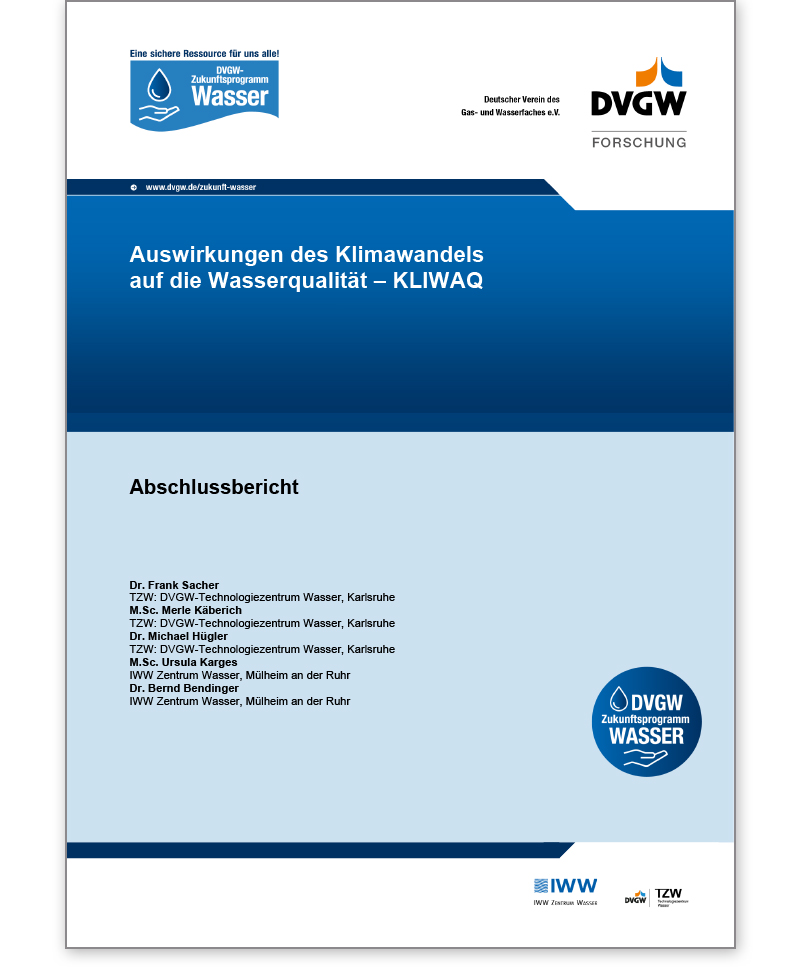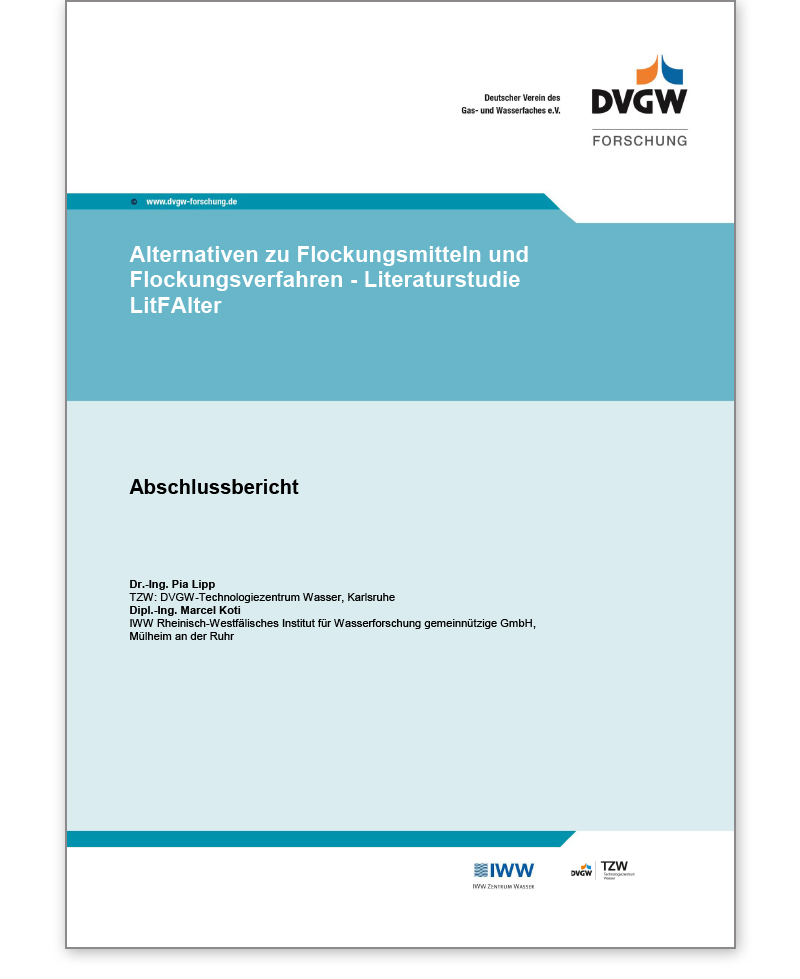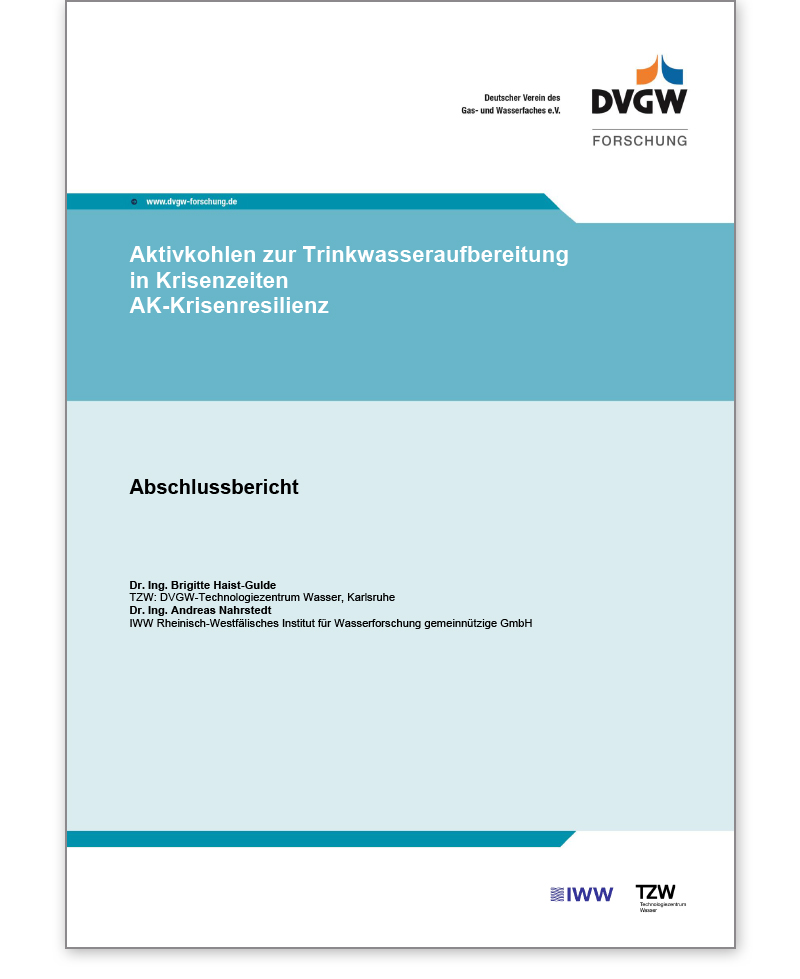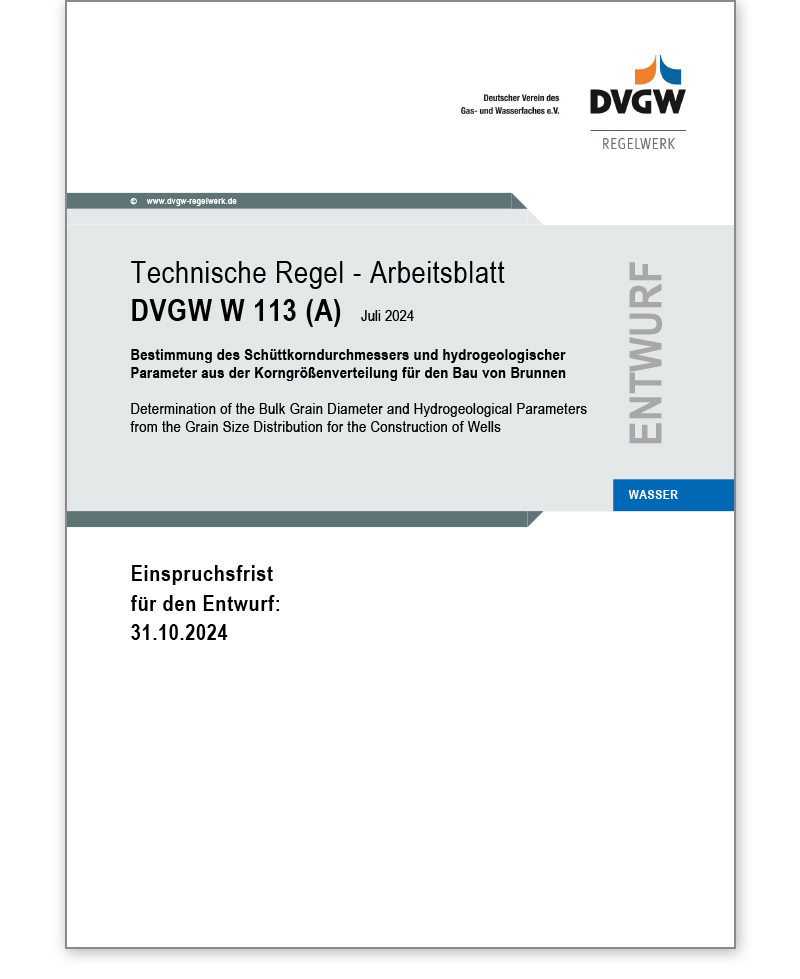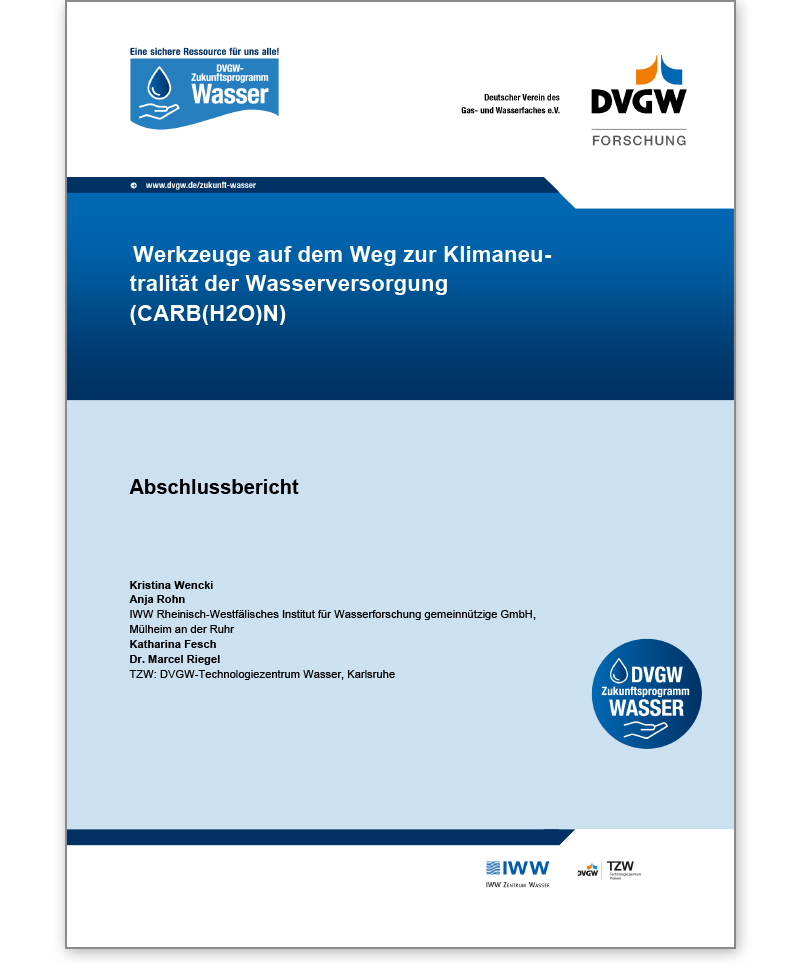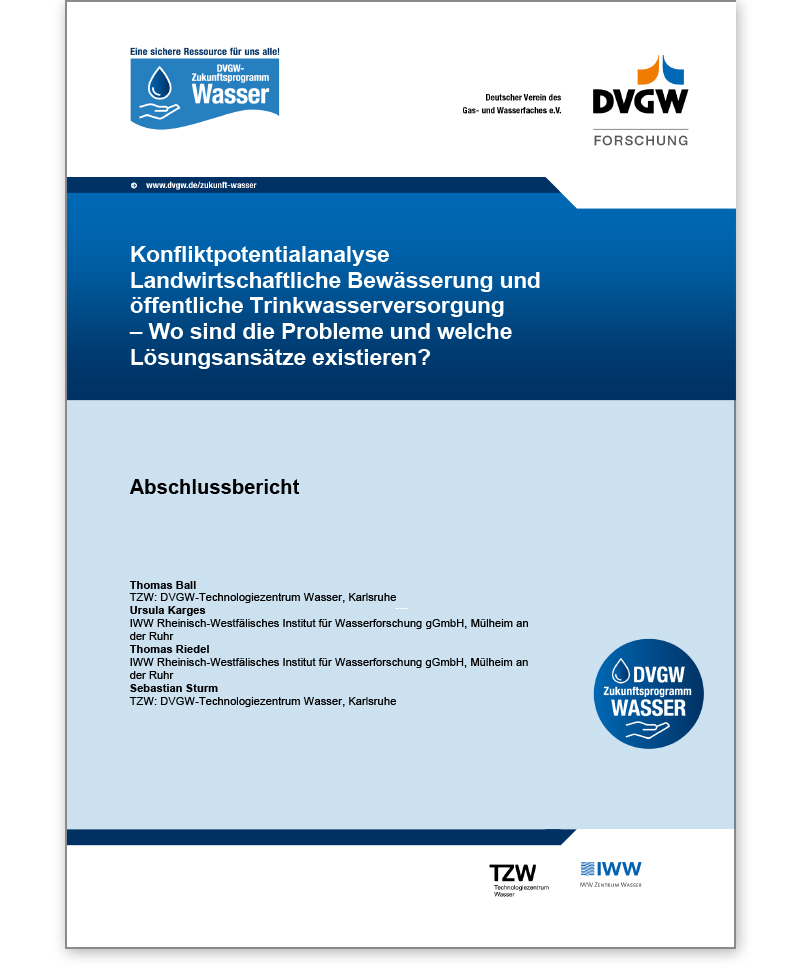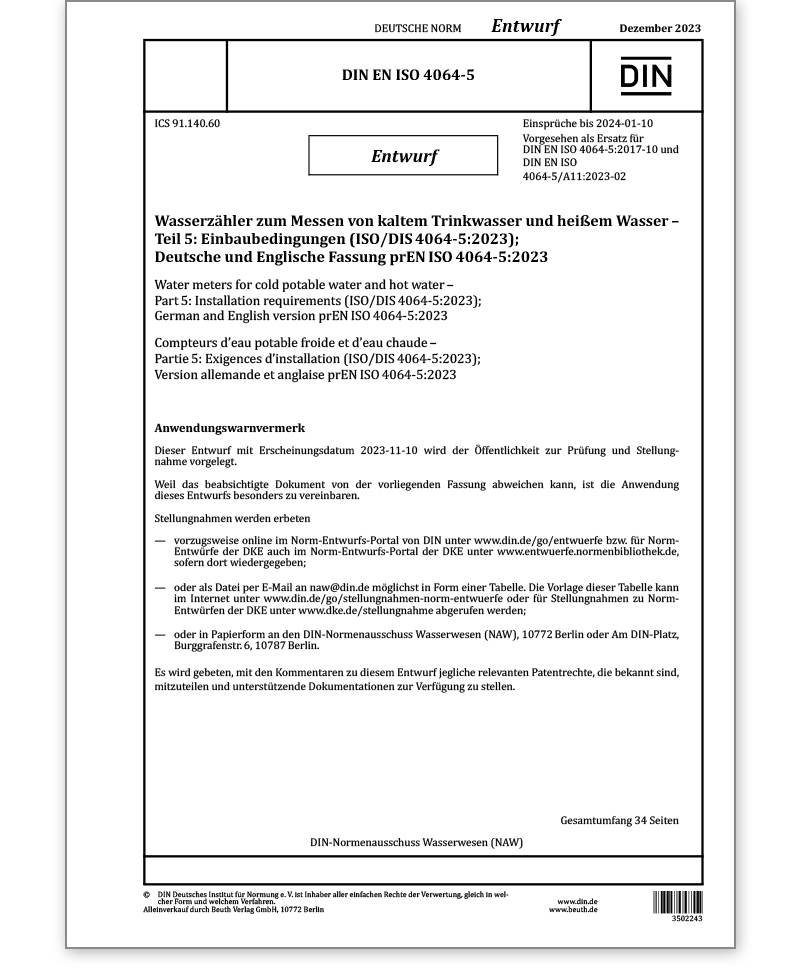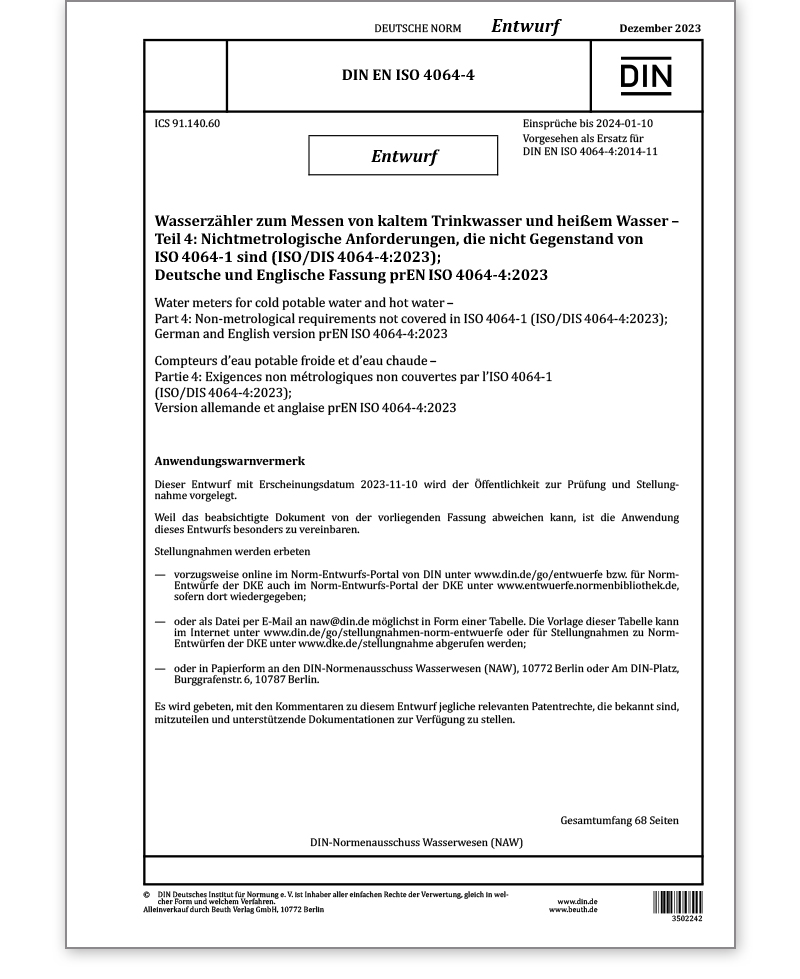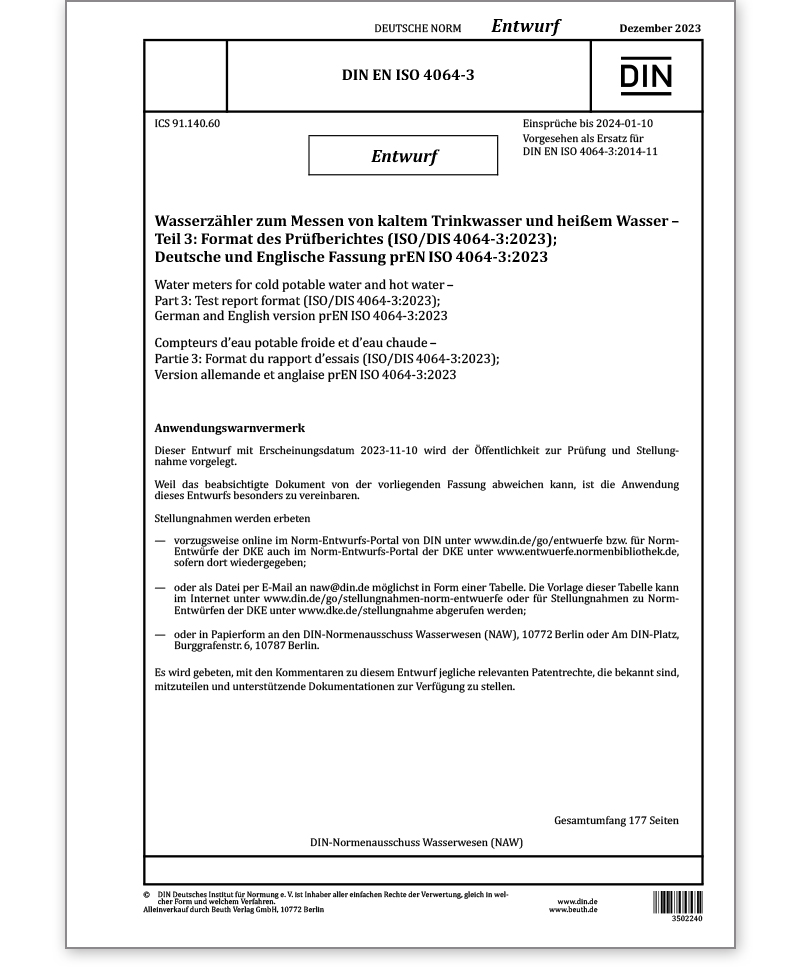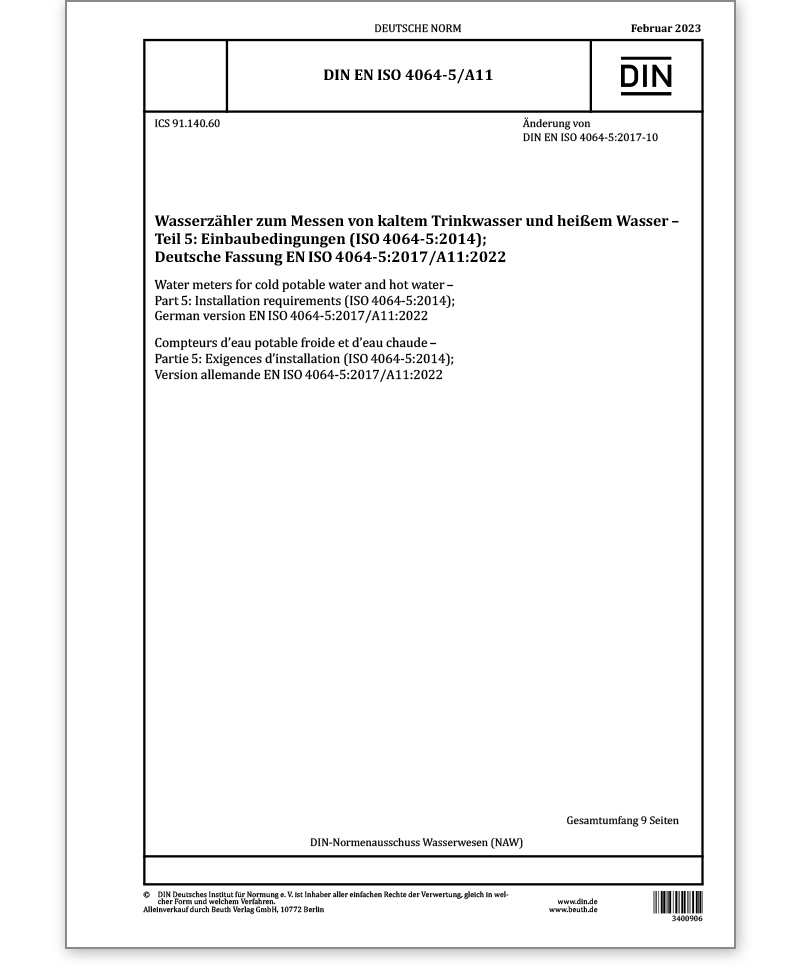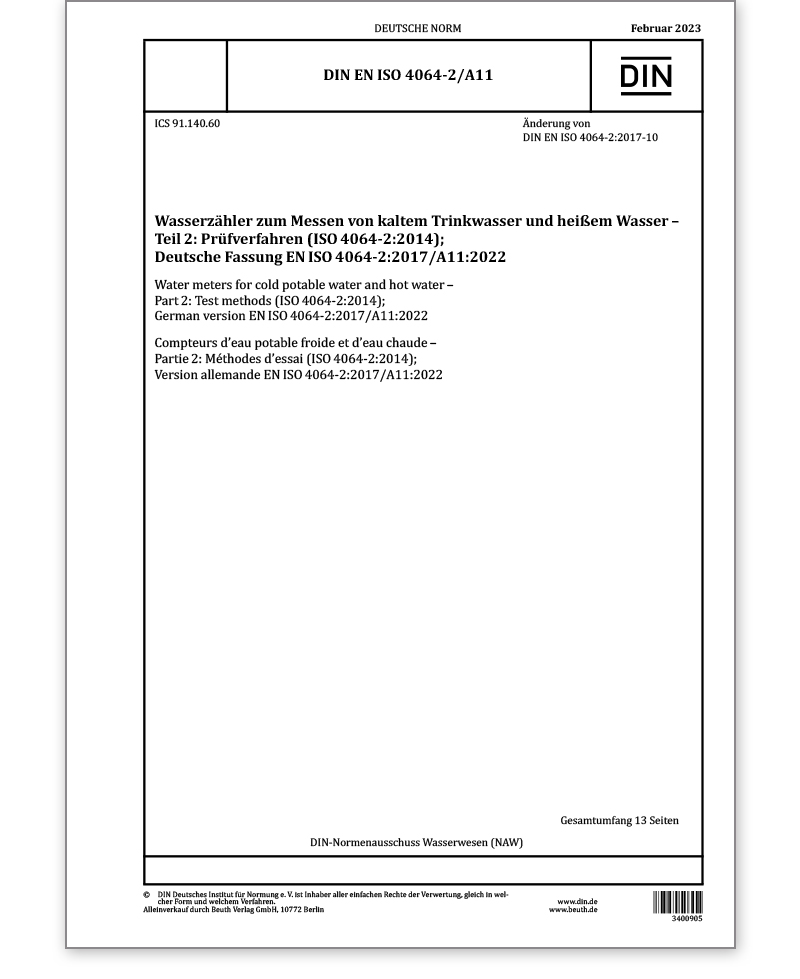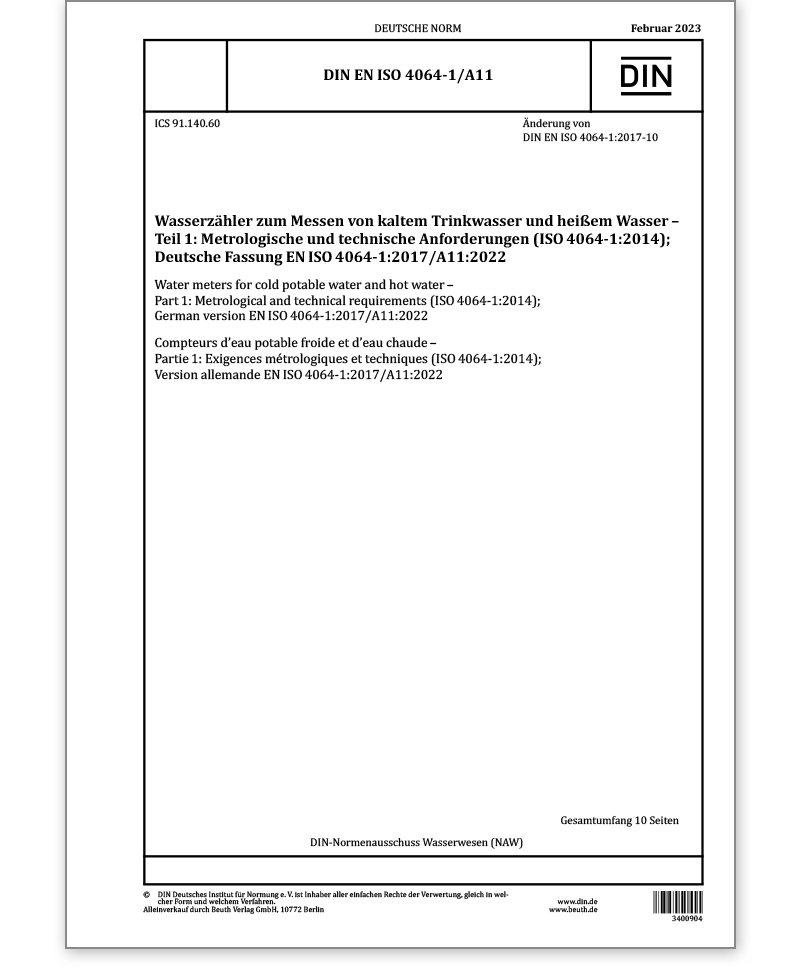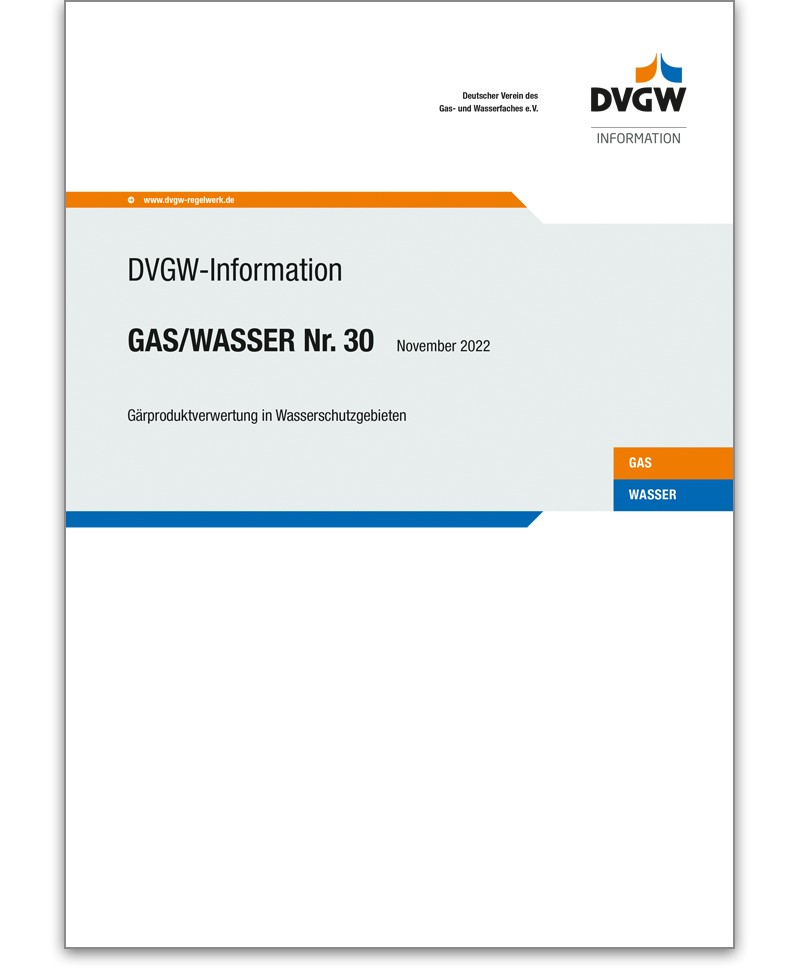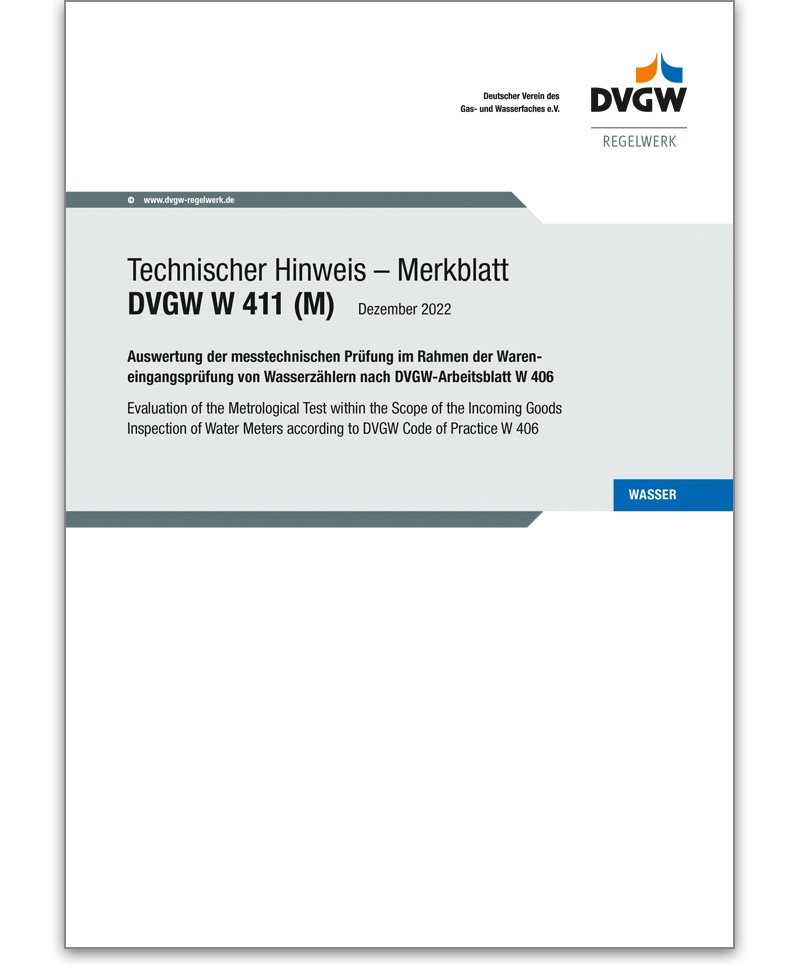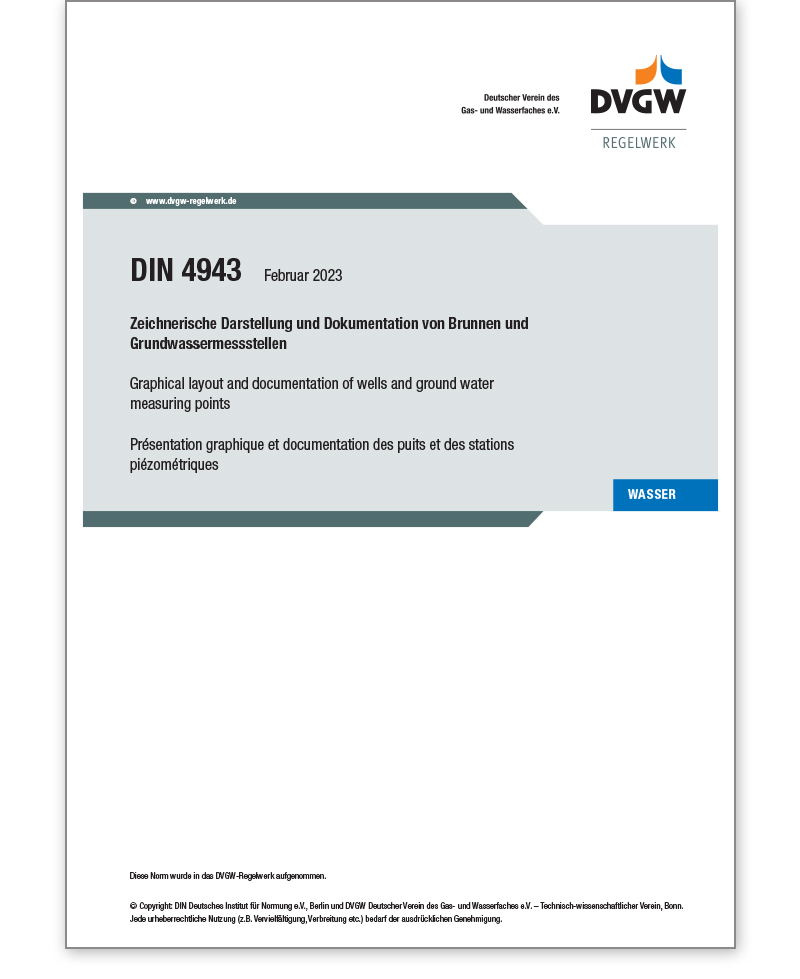Filter
–
Wasser Ressourcen
Die DVGW-Regelwerke und Normen dieser Rubrik beschäftigen sich mit dem Ressourcenmanagements und dem Schutz der für die Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserressourcen und Oberflächengewässer.
Forschungsbericht W 202127 12/2023
246,10 €*
In den letzten Jahren haben
klimatische Extremereignisse in Deutschland deutlich an Intensität und Frequenz
zugenommen. Langanhaltende Dürreperioden haben ebenso wie dramatische
Hochwasserereignisse zu massiven Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens geführt.
Die extremen Wettersituationen hatten auch weitreichende Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Neben den offensichtlichen Folgen für die Menge des
verfügbaren Wassers können sich klimatische Veränderungen auch auf die
Wasserqualität auswirken. Im Projekt KLIWAQ wurden die möglichen Auswirkungen
des Klimawandels auf die physikalische, chemische und mikrobiologische
Beschaffenheit des Roh- und Trinkwassers in Deutschland untersucht. Durch eine Umfrage, an der ca.
180 Wasserversorgungsunternehmen (WVU) teilgenommen haben, und die durch einen
Workshop ergänzt wurde, zeigte sich, dass die Auswirkungen des Klimawandels
aktuell in Deutschland vor allem WVU, die Wasser aus Flüssen, Seen oder
Tal-sperren zu Trinkwasser aufbereiten, aber auch Uferfiltratwasserwerke
betreffen. Bei WVU, die Grundwasser als Rohwasser nutzen, sind die Folgen
derzeit noch nicht in vergleichbarer Weise sichtbar. Die Unterschiede lassen
sich durch die unterschiedlichen Reaktionszeiträume und die Art der
Beeinflussung der Wasserressourcen erklären. Im Oberflächengewässer zeigen
sich Auswirkungen am schnellsten, während insbesondere im Porengrundwasser die
längsten Reaktionszeiträume und eine eher indirekte Beeinflussung vorliegen.
Langfristig sind aber auch für die WVU, die Grundwasser nutzen, Auswirkungen zu
erwarten.
Unabhängig von der Art des
Rohwassers wurden Temperaturveränderungen mit Abstand am häufigsten als bereits
heute auftretender Effekt genannt. Weitere mögliche Veränderungen der
Wasserbeschaffenheit als Folge des Klimawandels, die bereits heute vereinzelt
auftreten, betreffen ein geändertes Spektrum an organischen Spurenstoffen und
erhöhte Gehalte an Nährstoffen und anorganischen Inhaltsstoffen wie Eisen oder
Mangan. Auch bei den biologischen und mikrobiologischen Parametern ist mit
einer Veränderung des Spektrums, aber auch mit einem vermehrten Auftreten von
Krankheitserregern zu rechnen.
In Bezug auf zukünftige
Entwicklungen wurde in der Befragung deutlich, dass ungefähr die Hälfte der WVU
in der Zukunft verstärkte Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität
erwartet. Die unterschiedlich starken Auswirkungen abhängig von der Rohwasserart
sind bei den Zukunftserwartungen nicht mehr von großer Bedeutung. Gleichzeitig
ist bemerkenswert, dass etwa die Hälfte der WVU keine zunehmenden Auswirkungen
in der Zukunft erwartet, obwohl der Klimawandel und seine Folgen seit Jahren
stark diskutiert werden.
Die Ergebnisse des Projekts
zeigen auch, dass die zur Verfügung stehende Aufbereitungstechnik i. d. R.
ausreichend zu sein scheint, um die derzeitigen und in Zukunft zu erwartenden
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserbeschaffenheit zu beherrschen. Ist
eine zusätzliche Aufbereitung notwendig, sind jedoch auch immer die steigenden
Kosten für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu
beachten. Akuter Handlungsbedarf für die WVU in Deutschland lässt sich – mit
Ausnahme weniger Einzelfälle, beispielsweise einige Talsperrenwasserwerke, die
Probleme durch massive Waldschäden im Einzugsgebiet haben – aus den Ergebnissen
der vorliegenden Studie nicht ableiten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserbeschaffenheit in Deutschland in
ihrer Bedeutung wesentlich geringer sind als die Probleme, die mit einer
eingeschränkten Verfügbarkeit von Wasser verbunden sind.
Forschungsbericht W 202303 11/2023
246,10 €*
Im Rahmen der vorliegenden Studie, DVGW-Forschungsbericht W 202303, bei der TZW und IWW Hand in Hand
arbeiteten, wurden Literaturinformationen und Erfahrungsberichte zu verfügbaren
Flockungsmitteln, zur Möglichkeit des Flockungsmittelrecyclings und zu
Alternativen des Flockungsverfahrens bei der Wasseraufbereitung
zusammengetragen und ausgewertet. Alternative Verfahren zur DOC- und
Partikelentfernung wurden der klassischen Flockung gegenübergestellt. Hierbei
wurden auch Informationen zum Energiebedarf und sofern verfügbar zum Fußabdruck erfasst. Auch internationale Lösungen flossen in die Literaturstudie ein.
Da Flockungsmittel in der gewünschten und gemäß TrinkwV geforderten Reinheit nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, handelt sich um eine akute Aufgabenstellung für viele Wasserversorgungsunternehmen.
Der Schwerpunkt der Recherche wurde insbesondere auf die DOC-Entfernung gelegt, da diese in der Regel für
extrem hohe Dosiermengen an Flockungsmitteln sorgt.
Das gesammelte Wissen wurde in übersichtlicher Form zusammengestellt und soll allen interessierten WVUs zur
Verfügung gestellt werden.
Die Studie enthält aussichtsreiche Handlungsoptionen mit
Beschreibung der notwendigen Umsetzungsvorgänge. Sie sollen den
Wasserversorgern helfen, für sich geeignete Lösungen zu finden.
Forschungsbericht W 202219 09/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens W 202219 besteht in
der Zusammenstellung des Expertenwissens bezüglich der Rohstoff- und
Energiesituation bei der Aktivkohleherstellung, der Eigenschaften der
unterschiedlichen Aktivkohlen sowie den Erfahrungen im Bereich der Optimierung
des Aktivkohleeinsatzes bei Wasserversorgungsunternehmen. W 202219 zeigt Alternativen
zum Einsatz von Aktivkohlen auf und bewertet diese.
Lieferengpässe im Jahr 2022 waren darauf zurückzuführen,
dass pandemiebedingt die Lieferkette nur eingeschränkt funktionierte. Aktuell
hat sich diesbezüglich die Situation wieder entspannt. Doch auch zukünftig muss
mit Krisensituationen gerechnet werden. Daher ermittelt dieses
Forschungsvorhaben W 202219 Grundlagen, wie auf solche Krisen reagiert werden
kann.
Im Zusammenhang mit einem resilienten Umgang von Aktivkohle
ist ein erster Schritt die Prüfung von Maßnahmen für eine Minimierung des
Aktivkohlebedarfs, wie sie in W 202219 zusammengestellt sind. Dies beinhaltet
auch die Möglichkeit der Reaktivierung.
W 113 Entwurf Arbeitsblatt 07/2024
Preis ab:
79,28 €*
Das Arbeitsblatt W 113 Entwurf gilt für die Ermittlung des
erforderlichen Schüttkorndurchmessers des Filtermaterials beim Bau von Brunnen
in Lockergesteinen. Es kann auch für den Bau von Grundwassermessstellen
angewandt werden. Darüber hinaus werden Näherungsverfahren zur Bestimmung hydrogeologischer
Parameter aus der Korngrößenverteilung beschrieben.
Forschungsbericht W 202213 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die Zielsetzung des Forschungsberichtes W 202213 bestand daher in der Zusammenstellung der erforderlichen Wissensgrundlagen zur Entwicklung einer branchenspezifisch einheitlichen Vorgehensweise zur vollständigen, kennzahlenbasierten Ermittlung der Emissionen der Wasserversorgung, die durch die Unternehmenstätigkeit verursacht werden.Als erforderliche Wissensgrundlagen wurden vor Projektbeginn eine pragmatische Definition der Klimaneutralität in der Wasserversorgung, ein Begriffsglossar zur Klimaneutralität unter Berücksichtigung der ISO-Normung und eine Beschreibung und Interpretation der Inhalte der ISO-Normung sowie weiterer branchenspezifischer Standards und Regelwerke zur Klimaneut-ralität in der Wasserversorgung erachtet. Zusätzlich sollten Abgrenzungen und Schnittstellen zur Bilanzierung in der Abwasserwirtschaft definiert werden und ein Vorschlag zur weiteren gemeinsamen Bearbeitung des Themas für eine integrierte Bilanzierung der Treibhausemissi-onen der Wasserwirtschaft erarbeitet werden. Ein zentrales Ergebnis dieser verschiedenen Analysen und Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Grundlagen stellt die Ableitung eines Gliederungsvorschlags für eine Handreichung zur Treibhausgasbilanzierung und zum Klimamanagement in der Wasserversorgung dar, welche als Arbeitsgrundlage zur weiteren Bearbeitung an den PK-Klimaneutralität des DVGW übergeben wird. Der Arbeitsschritt der Definition von Schnittstellen zur Bilanzierung in der Abwasserwirtschaft und Ableitung von Potenzialen zur Harmonisierung der Methoden und branchenübergreifen-den Zielsetzungen zur Klimaneutralität in der Wasserwirtschaft wurde im Rahmen des Kickoff-Meetings zum Projekt in Übereinkommen mit der Projektbegleitgruppe als innerhalb der Pro-jektlaufzeit nicht realisierbar deklariert. Eine Abstimmung mit der DWA zur weiteren Harmoni-sierung der Bemühungen im Bereich der Klimaneutralität kann nur nach Vorliegen eines ersten Entwurfs der DVGW-Handreichung zum Thema erfolgen und stellt somit einen Arbeitsauftrag des DVGW PK Klimaneutralität dar.
Forschungsbericht W 202202 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Ein nachhaltiges Asset Management ist für alle
Wasserversorger das Handlungsgerüst zur Bewältigung der komplexen Aufgaben in Bezug auf alternde
Infrastrukturen und sich verändernde Rahmenbedingungen (Demographie, Klimawandel u.a.) in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten. Für den substanzorientierten Werterhalt der
Infrastruktur bedarf es moderner Methoden und Technologien, wobei der Digitalisierung für das
Asset Management eine tragende Rolle zukommt. Es sind am Markt viele verschiedene
Werkzeuge und digitale Tools verfügbar, die für Anlagen in der Wassergewinnung,
-aufbereitung und im Verteilungsnetz bereits Anwendung finden oder es zukünftig könnten. Aufgabe dieses
Projektes DVGW-Forschungsbericht W 202202 war es, einerseits Transparenz über bestehende digitale Tools im Asset
Management der Wasserversorgung zu schaffen, andererseits die damit verbundenen
Nutzungspotenziale zu ermitteln.
Dieses Vorhaben hat die Perspektive zukünftiger
Herausforderungen mit der Praxisperspektive verbunden. Es erfolgte die interaktive Erarbeitung von
möglichen Zielen für den Einsatz digitaler Tools im Asset Management und darauf aufbauend
eine Marktrecherche zu bereits am deutschen Markt verfügbarer Tools. Diese Übersicht stellt
ausgewählte Tools strukturiert nach den Hauptprozessen im Technischen Anlagenmanagement
(TAM) als Teil des Asset Management dar (sog. Tool-Landkarte). In Kurzsteckbriefen
werden den Hauptprozessen zugeordnete Aufgaben mit den hierfür zur Verfügung stehenden Tools mit
ihren wichtigen Merkmalen dokumentiert. Im Rahmen des Projektes wurden auch Hemmnisse
für den bisher teils noch geringen Einsatz digitaler Werkzeuge erarbeitet und
sind in diesem Bericht als Herausforderungen mit dokumentiert. Es erfolgte auch ein Abgleich mit
Entwicklungen in den Niederlanden. Der Bericht schließt mit einer Einschätzung über die
zukünftig zu erwartenden Handlungsstränge im Asset Management in der Wasserversorgung.
Forschungsbericht W 202125 01/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die seit einigen Jahren in Deutschland beobachtete
Ausweitung des Anbaus von landwirtschaftlichen Kulturen mit Bewässerungsbedarf
in Kombination mit zunehmenden sommerlichen Trockenperioden lässt einen
steigenden Bedarf von Wasser zur Bewässerung und damit, zumindest in einigen
Regionen, eine zunehmende Konkurrenz um die begrenzte Ressource Wasser zwischen
der öffentlichen Wasserversorgung und der Landwirtschaft erwarten.
Ziel des vorliegenden Projektes war es, konkrete
Ansatzpunkte und Verfahren zum Management von Nutzungskonflikten, um die
Ressource Grundwasser in Regionen mit Bewässerung auf der Ebene eines einzelnen
Einzugsgebiets zu erarbeiten.
Dafür wurde relevante Literatur im Hinblick auf die
Fragestellung ausgewertet und Interviews mit verschiedenen Experten und
Akteuren geführt. Unter anderem wurden zwei Beispiele für Verbände näher
betrachtet, die schon seit vielen Jahren eine großflächige Bewässerung in ihren
Gebieten ermöglichen und dabei eine nachhaltige Nutzung von
Grundwasserressourcen anstreben. Eine dieser Beispielregionen liegt in
Niedersachsen, eine weitere in Rheinland-Pfalz. Sowohl deren Organisation und
Entwicklung als auch die Vorgehensweise und die Randbedingungen wurden
erläutert.
Basierend auf den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche
und den Experteninterviews wurde ein Konzeptpapier zum erfolgreichen Konfliktmanagement
erarbeitet, in dem die erforderlichen Voraussetzungen, aber auch die
Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Akteure (Landwirtschaft,
Genehmigungsbehörden, Wasserversorger) zusammengestellt sind. Dies soll als
Hilfestellung dienen, um in betroffenen Regionen fallspezifische Lösungen
erarbeiten zu können.
DIN EN ISO 4064-5 Entwurf 12/2023
Preis ab:
77,90 €*
DIN EN ISO 4064-5 Entwurf gilt für Wasserzähler zur Volumenmessung von kaltem Trinkwasser und
heißem Wasser, das durch eine vollständig gefüllte, geschlossene Leitung fließt. Diese Wasserzähler sind mit
Einrichtungen versehen, die das kumulierte Volumen anzeigen. Dieser Teil der DIN EN ISO 4064 legt Kriterien für die Auswahl von einzelnen Wasserzählern, Verbundzählern
und konzentrischen Wasserzählern, zugehörigen Armaturen, den Einbau, besondere Anforderungen an Zähler
und die Inbetriebnahme von neuen oder reparierten Zählern fest, um eine genaue konstante Messung und
zuverlässige Ablesung der Zähler sicherzustellen.Zusätzlich zu den auf mechanischen Funktionsprinzipien beruhenden Wasserzählern gilt der vorliegende Teil
der ISO 4064 ebenfalls für Wasserzähler, die auf elektrischen oder elektronischen Funktionsprinzipien beruhen,
und für Wasserzähler nach mechanischem Funktionsprinzip mit elektronischen Einrichtungen, die zur
Messung des Volumens von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser dienen. Er gilt außerdem für elektronische
Zusatzeinrichtungen. Zusatzeinrichtungen sind optional. In nationalen oder internationalen Vorschriften
können allerdings einige Zusatzeinrichtungen hinsichtlich der Verwendung von Wasserzählern verbindlich
vorgeschrieben sein. Die Empfehlungen dieses Teils der DIN EN ISO 4064 gelten für Wasserzähler unabhängig von der Technologie, die als
integrierende Messgeräte das Volumen des sie durchlaufenden Wassers bestimmen.
DIN EN ISO 4064-4 Entwurf 12/2023
135,80 €*
DIN EN ISO 4064-4 Entwurf gilt für Wasserzähler zur Volumenmessung von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser,
das durch eine vollständig gefüllte, geschlossene Leitung fließt. Diese Wasserzähler sind mit Einrichtungen versehen, die das kumulierte Volumen anzeigen. Das Dokument legt technische Eigenschaften und Anforderungen für den Druckverlust für Wasserzähler für kaltes Trinkwasser und heißes Wasser fest.Zusätzlich zu den auf mechanischen Funktionsprinzipien beruhenden Wasserzählern gilt der vorliegende Teil
der ISO 4064 ebenfalls für Wasserzähler, die auf elektrischen oder elektronischen Funktionsprinzipien beruhen
und für Wasserzähler nach mechanischen Funktionsprinzipien mit elektronischen Einrichtungen, die zur
Messung des Volumendurchflusses von heißem Wasser und von kaltem Trinkwasser dienen. Er gilt außerdem
für elektronische Zusatzeinrichtungen. Zusatzeinrichtungen sind grundsätzlich optional. Jedoch können
in nationalen oder internationalen Vorschriften einige Zusatzeinrichtungen hinsichtlich der Verwendung von
Wasserzählern verbindlich vorgeschrieben sein.
DIN EN ISO 4064-3 Entwurf 12/2023
238,80 €*
DIN EN ISO 4064-3 Entwurf legt ein Prüfberichtformat fest, das in Verbindung mit
ISO 4064-1 und ISO 4064-2 für Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser anzuwenden ist.
DIN EN ISO 4064-5/A11 02/2023
Preis ab:
49,20 €*
Bei DIN EN ISO 4064-5 A/11 handelt es sich um eine
Überarbeitung. Festgelegt sind Kriterien für die Auswahl von einzelnen
Wasserzählern, Verbundzählern und konzentrischen Wasserzählern, zugehörigen
Armaturen, der Einbau, besondere Anforderungen an Zähler und die Inbetriebnahme
von neuen oder reparierten Zählern, um eine genaue konstante Messung und
zuverlässige Ablesung der Zähler sicherzustellen.
DIN EN ISO 4064-2/A11 02/2023
77,00 €*
Bei DIN EN ISO 4064-2 A/11 handelt es sich um eine
Überarbeitung. Diese gilt für die Bauartbeurteilung und die Ersteichung von
Wasserzählern zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser, die in DIN
EN ISO 4064-1 definiert sind. Die OIML-Konformitätszertifikate können für
Wasserzähler ausgestellt werden, die in den Anwendungsbereich des OIML-Zertifizierungssystems
fallen, vorausgesetzt, dass die ersten drei Teile der DIN EN ISO 4064 in
Übereinstimmung mit den Regeln des Systems angewendet werden. Diese Europäische
Norm legt die Einzelheiten des Prüfprogramms, Grundsätze, Ausrüstung und
Verfahren fest, die für die Bauartbeurteilung und die Ersteichung zum Einsatz
kommen.
DIN EN ISO 4064-1/A11 02/2023
Preis ab:
49,20 €*
Bei DIN EN ISO 4064-1 A/11 handelt es sich um eine
Überarbeitung. Festgelegt sind die Bedingungen, die die Wasserzähler erfüllen
müssen, um den Anforderungen des gesetzlichen Messwesens in den Ländern zu
entsprechen, in denen diese Messgeräte der staatlichen Aufsicht unterliegen.
Dieses Dokument gilt auch für Wasserzähler nach elektrischem oder
elektronischem Funktionsprinzip und für Wasserzähler nach mechanischem
Funktionsprinzip mit elektronischen Einrichtungen, die zur Messung des
Durchflussvolumens von heißem Wasser und von kaltem Trinkwasser dienen. Es gilt
ferner für elektronische Zusatzeinrichtungen. Zusatzeinrichtungen sind
optional. Jedoch können in nationalen oder internationalen Regelungen einige
Zusatzeinrichtungen hinsichtlich der Verwendung von Wasserzählern verbindlich
vorgeschrieben sein.
DVGW-Information GAS/WASSER Nr. 30 11/2022
48,47 €*
DVGW-Information GAS/WASSER Nr.30 beschäftigt sich mit der
Gärproduktverwertung in Wasserschutzgebieten.
An die Ausbringung von Gärprodukten in Wasserschutzgebieten
sind besondere Anforderungen zu stellen, um die damit verbundenen möglichen
Gefährdungen zu minimieren bzw. zu vermeiden.
Gärprodukte im Sinne dieser Information sind gütegesicherte
Gärrückstände aus der Biogaserzeugung.
Es gilt die grundsätzliche Anforderung an die landwirtschaftliche
Verwertung von Gärprodukten, dass diese eine gewässerverträgliche
Beschaffenheit aufweisen müssen und zudem ein entsprechendes Prüfungs- und
Qualitätssicherungssystem (Gütesicherung) besteht.
Über diese Gütesicherung muss der Nachweis erbracht werden,
dass zur landwirtschaftlichen Verwertung in Trinkwasserschutzgebieten
vorgesehene Gärprodukte relevante Schadstoffparameter nicht überschreiten.
Mit der Anwendung der DVGW-Information Gas/Wasser Nr. 30 können
die Anforderungen des vorsorgenden Schutzes der Trinkwasserressourcen mit der
landwirtschaftlichen Verwertung von geeigneten Gärprodukten in Trinkwasserschutzgebieten
in Einklang gebracht werden.
W 411 Merkblatt 12/2022 (Wasserzähler)
Preis ab:
62,03 €*
Dieses DVGW-Merkblatt W 411 konkretisiert das Verfahren der
Variablenprüfung der Wareneingangsprüfung nach Anhang E, DVGW-Arbeitsblatt W
406 „Wasserzählermanagement“.
Die Qualität der gelieferten Wasserzähler stellt für
Wasserversorgungsunternehmen die Basis einer einwandfreien Wassermessung dar.
Um diese Qualität zu gewährleisten, müssen nach DVGW-Arbeitsblatt W 406 die
angelieferten Wasserzähler bereits bei Wareneingang (Gefahrenübergang)
kontrolliert werden.
Im Zuge der nach DVGW-Arbeitsblatt W 406 beschriebenen
Wareneingangsprüfung ist zu prüfen, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen
eingehalten werden. Sollen Mängelansprüche geltend gemacht werden, ist es
erforderlich, dass nachgewiesen werden kann, dass die gelieferten Wasserzähler
bei Gefahrenübergang nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hatten.
Ein mögliches Verfahren für die Wareneingangsprüfung von
Wasserzählern ist in Anhang E, DVGW-Arbeitsblatt W 406 beschrieben.
Die im Zuge dieser Wareneingangsprüfung beschriebenen
Qualitätsannahmeprüfungen hinsichtlich äußerer, mechanischer, messtechnischer
und hygienischer Beschaffenheit von Wasserzählern gliedern sich in
Attributprüfung und Variablenprüfung.
Die der Variablenprüfung hinterlegten statistischen Methoden
führen in der Anwendung der Qualitätsannahmeprüfungen zu
Umsetzungsunsicherheiten. Daher werden im vorliegenden Merkblatt die
notwendigen Methoden erläutert und die Auswertung von Variablenprüfungen mit
einem Referenzbeispiel unterstützt.
DIN 4943 02/2023
Preis ab:
112,30 €*
Bei DIN 4943 handelt es sich um eine aktualisierte
Neuausgabe. Festgelegt ist die zeichnerische Darstellung von Bohrbrunnen und
Grundwassermessstellen. Die Darstellungen beziehen sich insbesondere auf die
relevanten Daten der Brunnenbohrung, des Brunnenausbaus, der eingebrachten
Schüttgüter sowie auf den Rückbau und die Sanierung von Brunnen. Neben den
zeichnerischen und graphischen Festlegungen werden auch die Kennfarben und die
ergänzenden verbalen Aussagen benannt. In den Anhängen werden Muster und
Ausführungsbeispiele für die darzustellenden und zu dokumentierenden
technischen und hydrologischen Daten angegeben. Die Norm richtet sich an
Planer, Brunnenbauer und Betreiber der Anlagen. Berücksichtigt werden die
Vorgaben der elektronischen Datenverarbeitung für die graphische und
tabellarische Dokumentation aller für die Bauwerke wichtigen Daten.