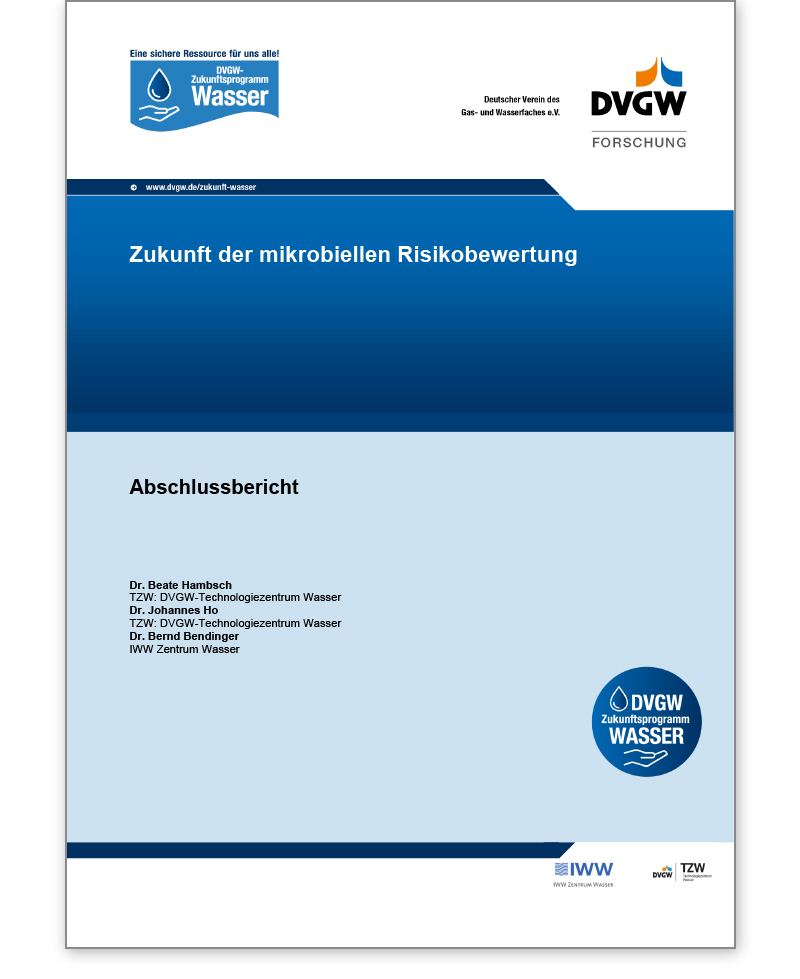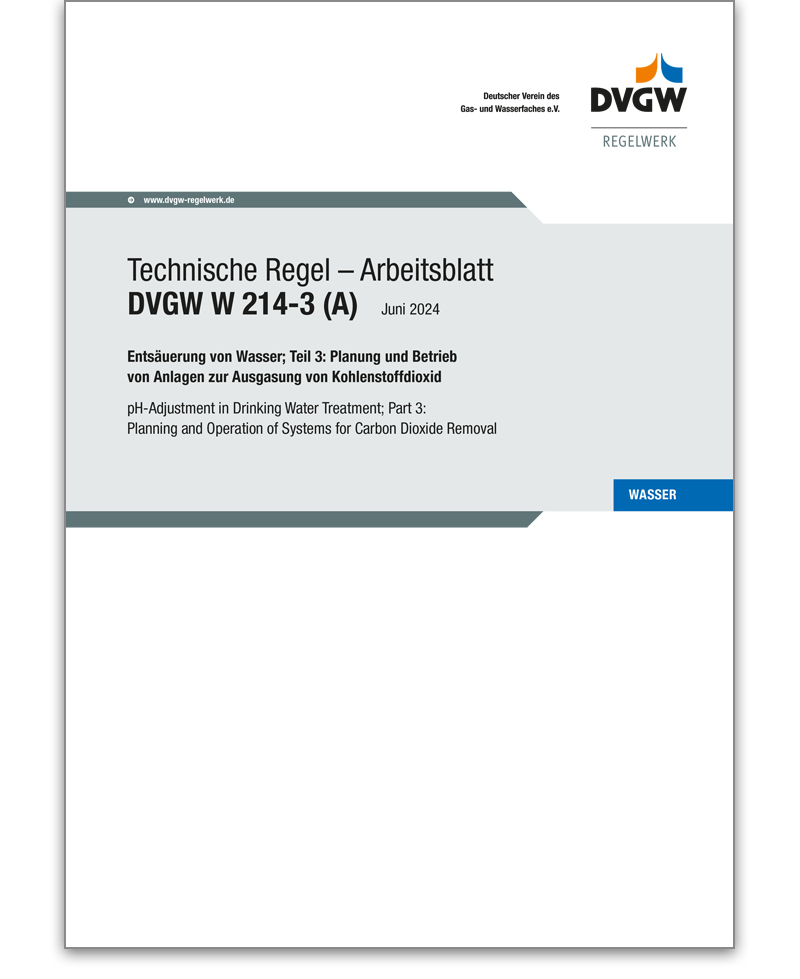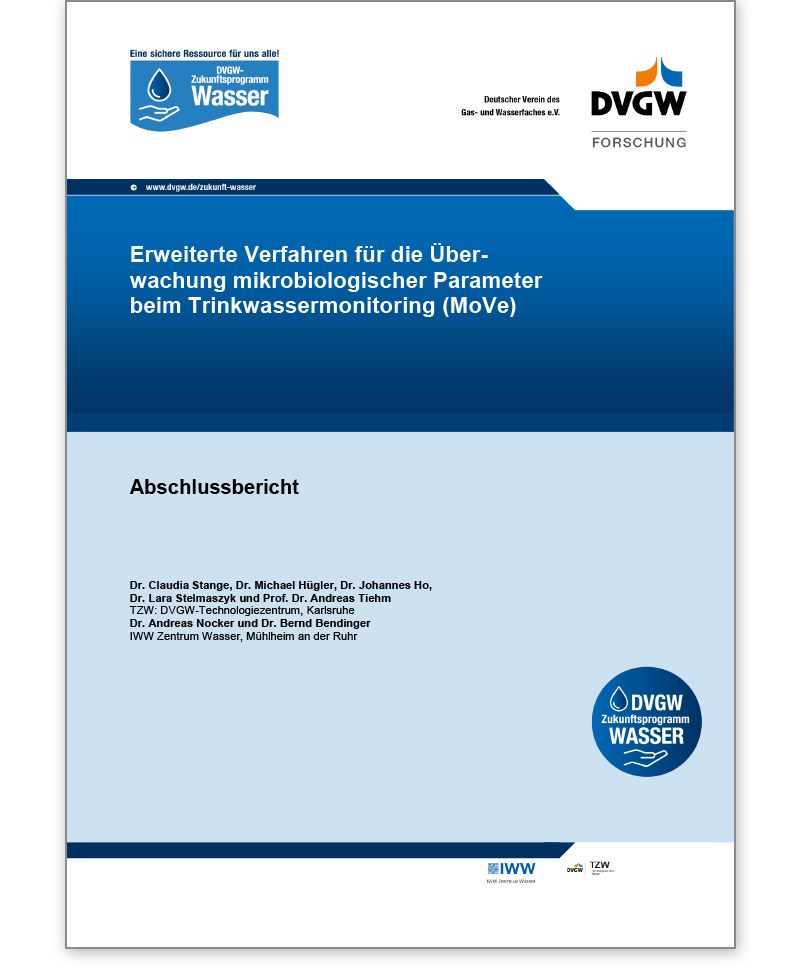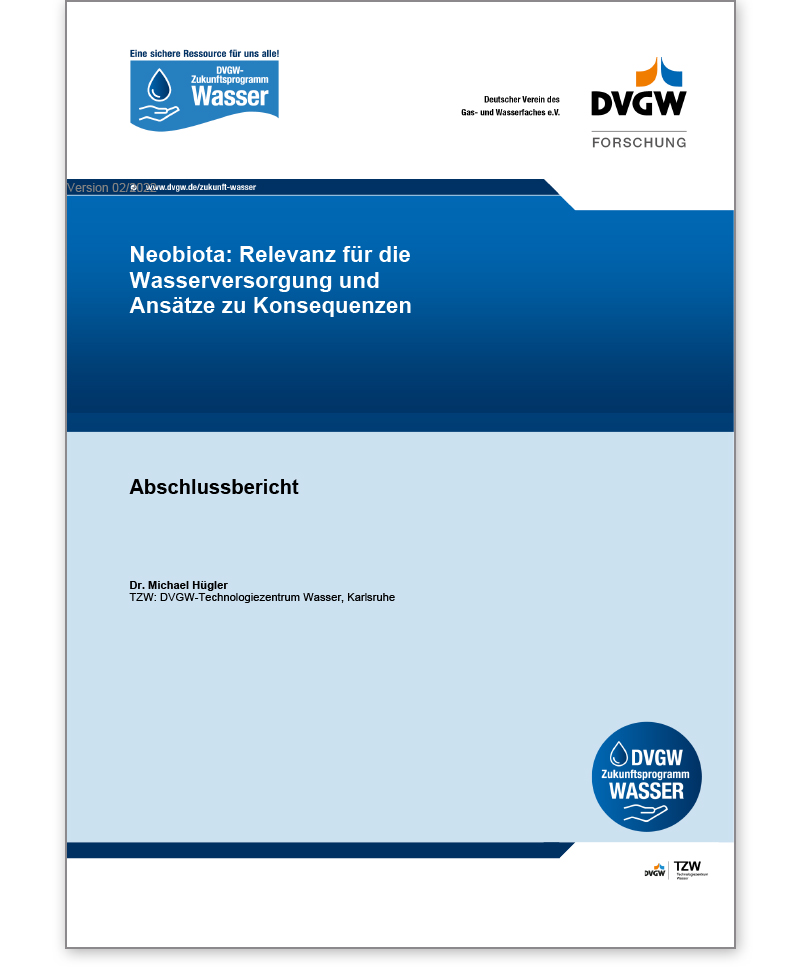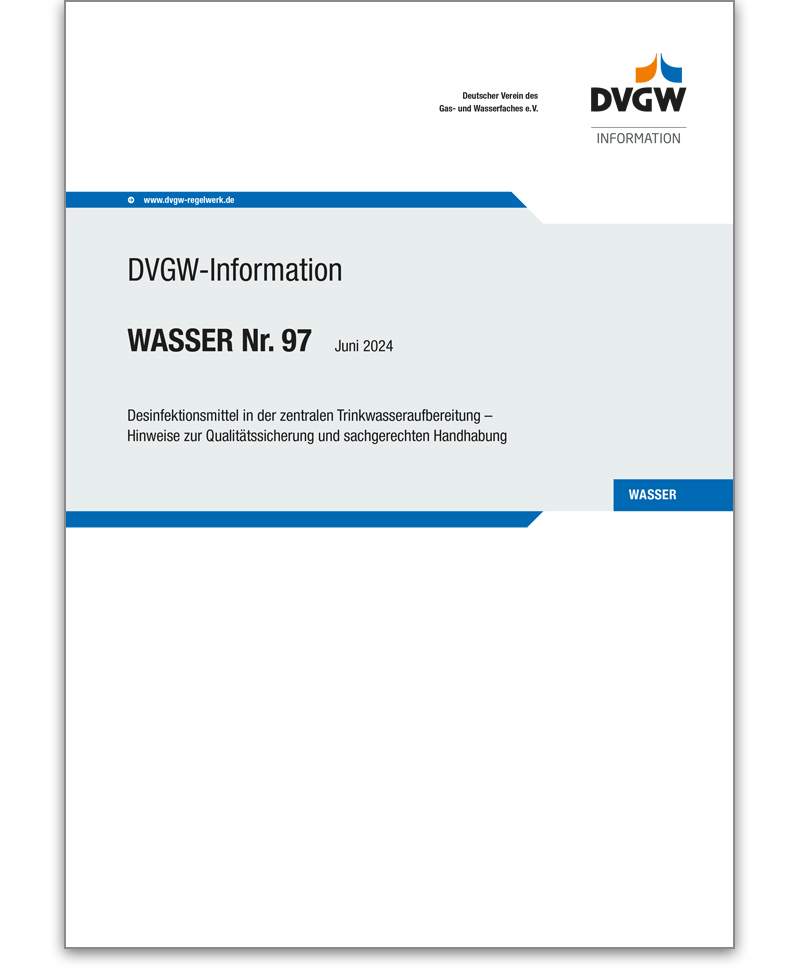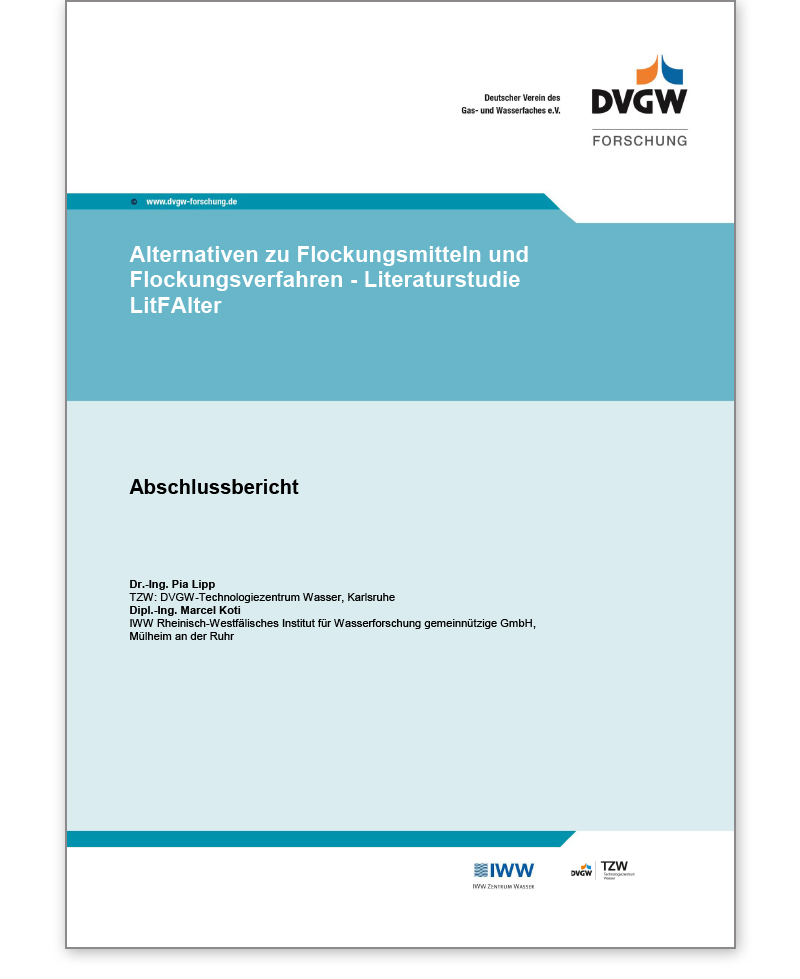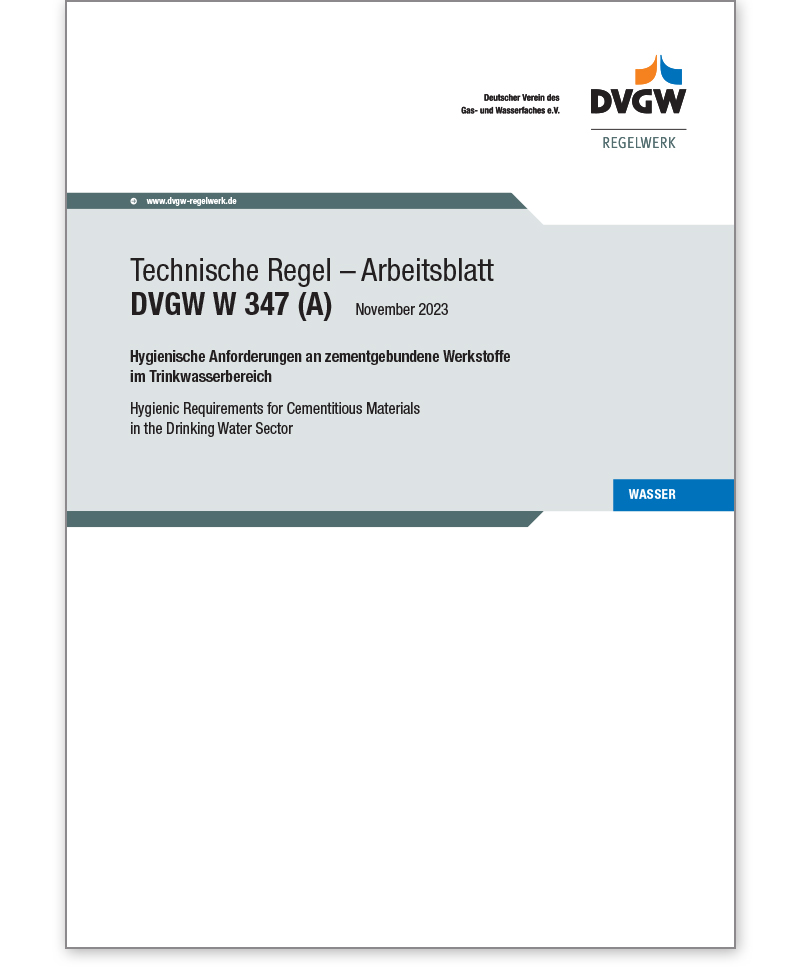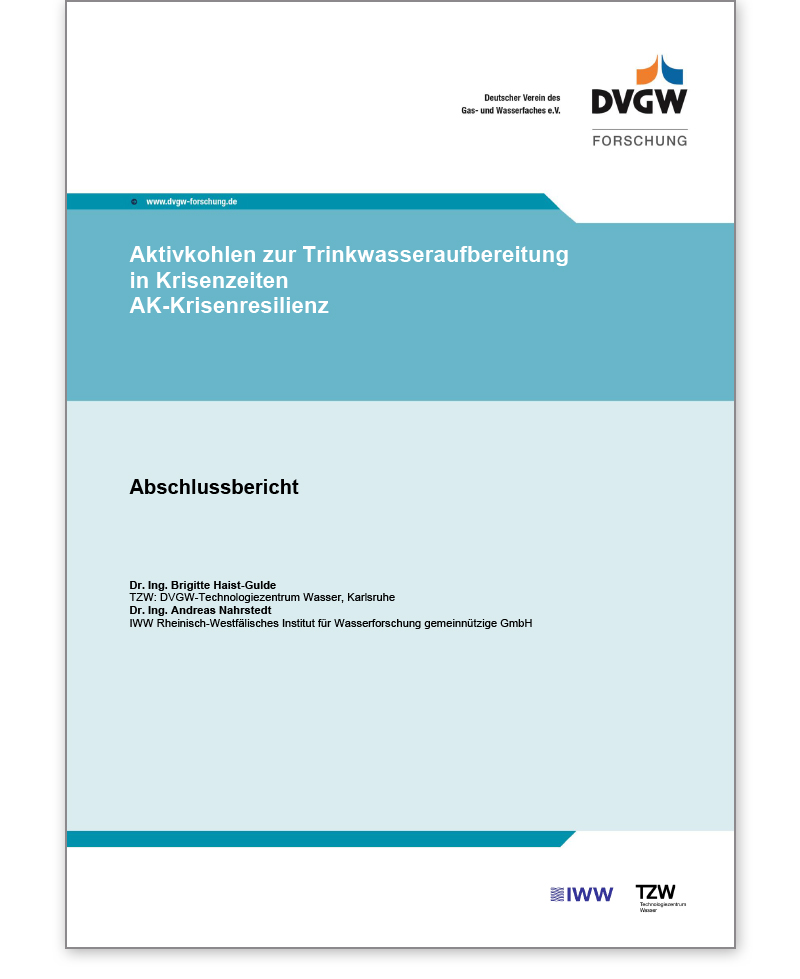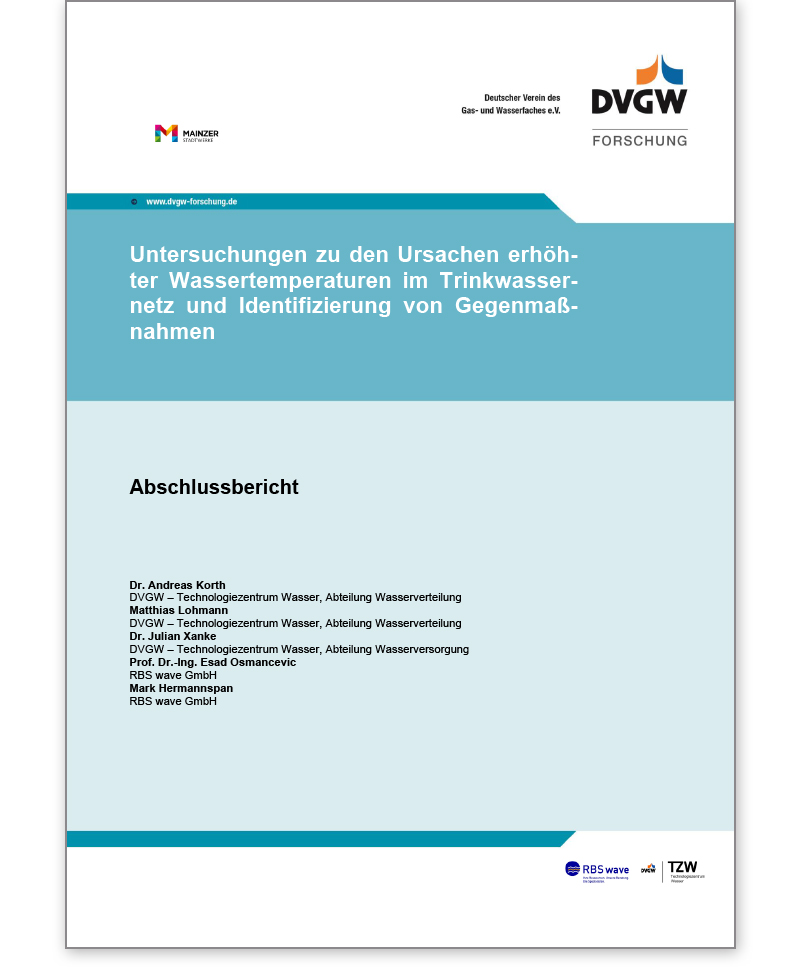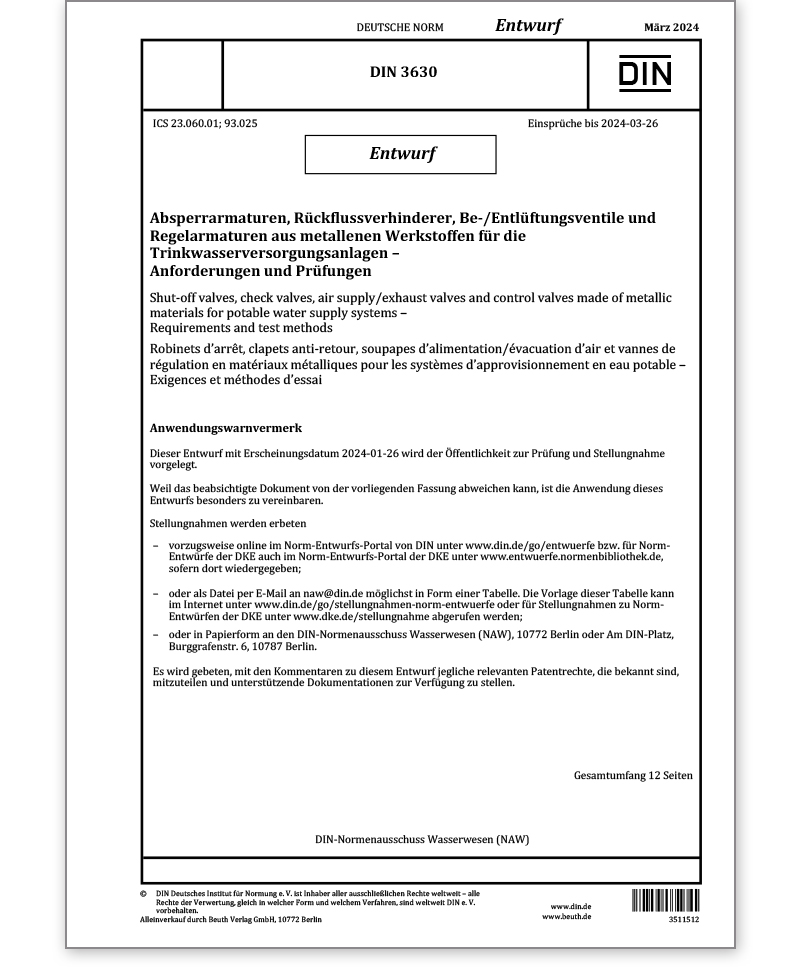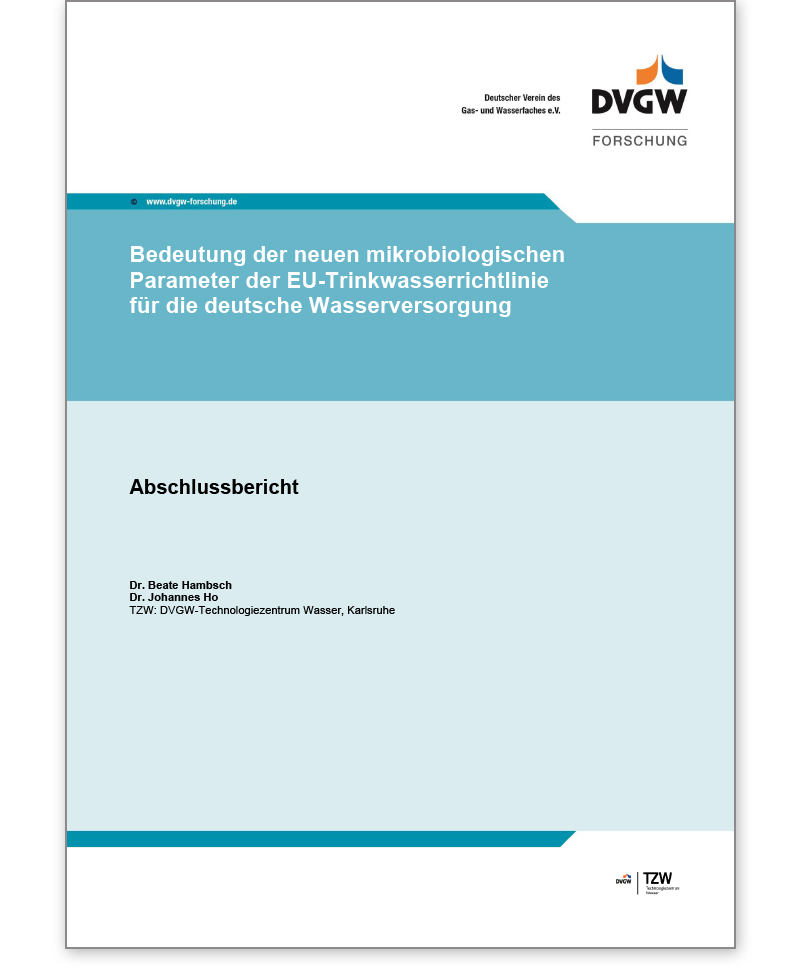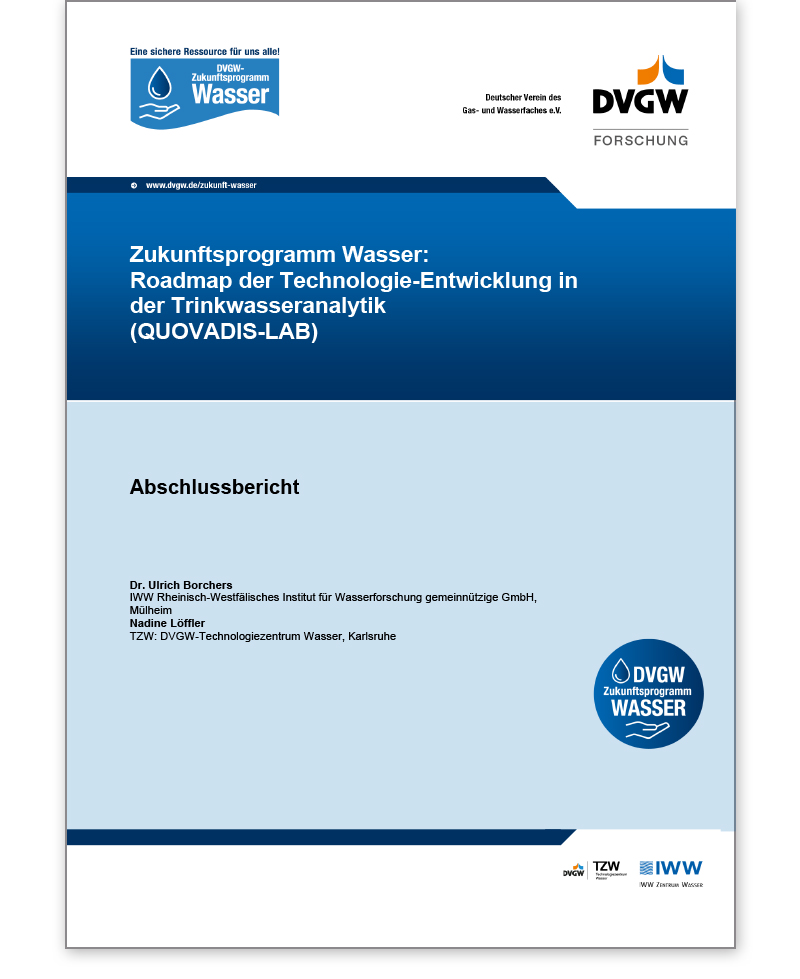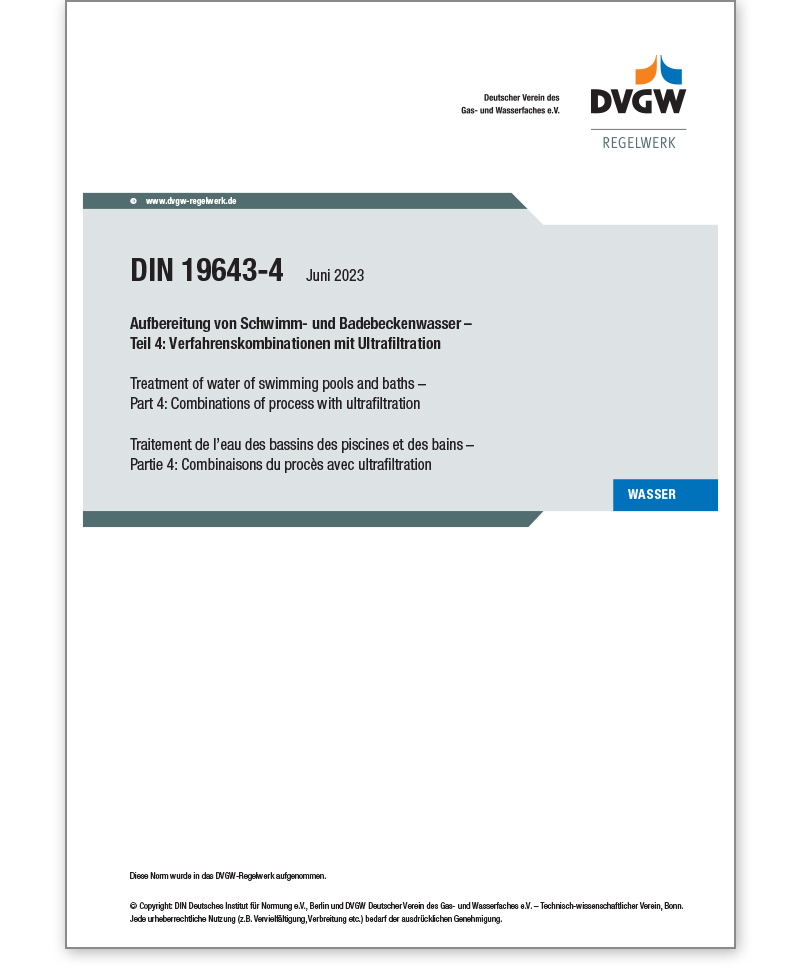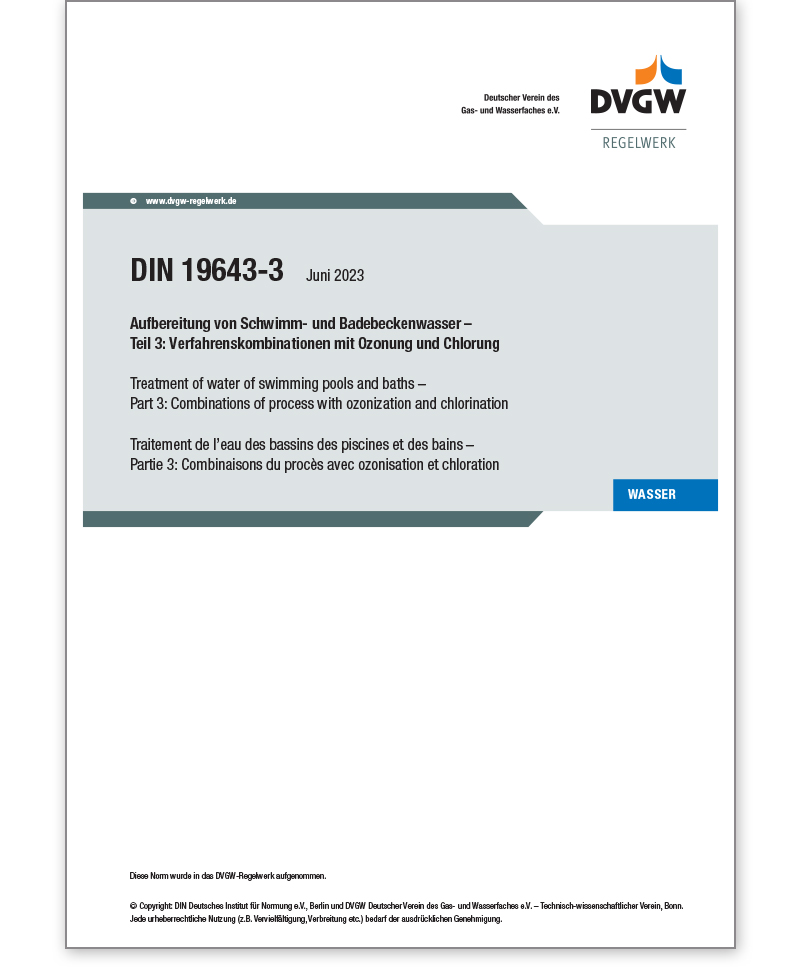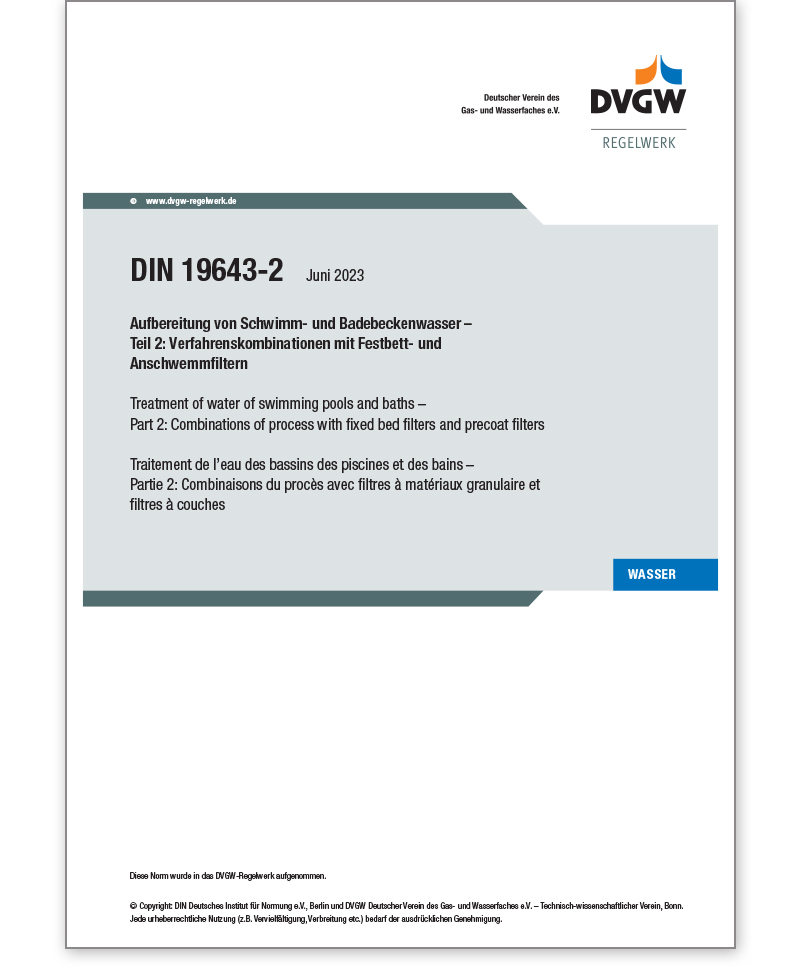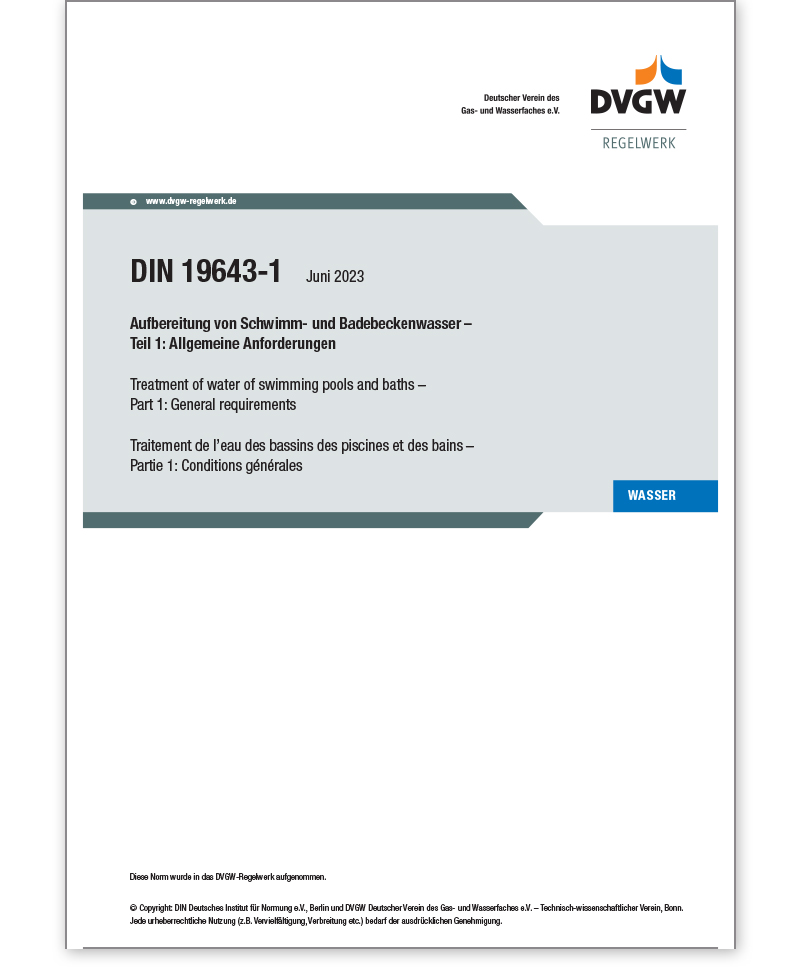Filter
–
Wasser Aufbereitung
Themen der Wasseraufbereitung werden in dieser Rubrik behandelt. Dazu gehören unterschiedliche Aufbereitungsmethoden, Desinfektionsmittel und das Strahlenschutzrecht. Ein weiteres Thema ist die Energieeffizienz in der Wasserversorgung.
Forschungsbericht W 202215 03/2024
246,10 €*
Zur routinemäßigen Überwachung des Trinkwassers auf hygienische Verunreinigungen wird in Deutschland seit mehr als 100 Jahren das
Indikatorprinzip angewendet. Dabei wird die potenzielle Anwesenheit von fäkalen
Krankheitserregern über den Nachweis von fäkalen Indikatororganismen
detektiert. Aufgrund der Entwicklung der mikrobiologischen Analytik in den
letzten Jahren und der Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie, stellt sich
die Frage, welche Änderungen sich für die mikrobiologische
Trinkwasserüberwachung unter dem risikobasierten Ansatz ergeben könnte.
Im Rahmen dieser Studie Forschungsbericht W 202215 wurden die
verschiedenen methodischen Bewertungsansätze zusammengestellt, verglichen und
hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Trinkwasserversorgung in
Deutschland beurteilt. Daraus sollten Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der
Bewertungssysteme mikrobiologischer Parameter abgeleitet werden.
Um diese Ziele zu erreichen, wurde zur zentralen Erfassung der
Kenntnisse und Meinungen eine Umfrage bei deutschen WVU durchgeführt. Darüber
hinaus wurden ein online-Workshop mit der KWR (gesetzliche Regelung in den
Niederlanden) und ein Präsenzworkshop im TZW Karlsruhe durchgeführt, um eine
Diskussion auf breiter Basis zu ermöglichen. Neben WVU und DVGW-Gremien wurden
auch Behördenvertreter eingeladen.
Es zeigte sich, dass sowohl die Kommunikation des Risikos als auch eine Regelung
zur Durch-führung einer QMRA sehr komplexe Themen sind, die nicht einfach
gelöst werden können. Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass beide
Verfahren sehr unterschiedliche Zielsetzungen haben. Dementsprechend können sie
sich nicht gegenseitig ersetzen. Die Anwendung des Fäkalindikatorprinzips in
der routinemäßigen mikrobiologischen Trinkwasserüberwachung und die
Durchführung einer QMRA sind sich ergänzende Verfahren.
W 214-3 Arbeitsblatt 06/2024
Preis ab:
62,03 €*
Das Arbeitsblatt W 214-3 gilt für die Entsäuerung von Wasser
durch Ausgasung von Kohlenstoffdioxid bei der zentralen Aufbereitung, um die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung an die Wasserstoffionen-Konzentration
(pH-Wert) und die Calcitlösekapazität zu erfüllen.
Die grundlegenden Aussagen sind auch gültig für Anwendungen,
bei denen die Kohlenstoffdioxid-Entfernung anderen Zielen dient; z. B. der
Teilentsäuerung im Aufbereitungsprozess oder der Entsäuerung von harten Wässern
über den Sättigungs-pH-Wert hinaus (z. B. als erste Stufe einer
Entcarbonisierung).
Auf andere Gasaustauschprozesse (z. B. Austrag von Radon,
Ozon, Schwefelwasserstoff, Methan, leicht-flüchtige Halogenkohlenwasserstoffe;
Eintrag von Sauerstoff), wird in diesem Arbeitsblatt nicht eingegangen.
Forschungsbericht W 202214 03/2024
246,10 €*
Im Projekt
DVGW-Forschungsbericht W 202214, MoVe, wurden molekulardiagnostischen Werkzeuge
für das mikrobiologische Monitoring evaluiert. Insgesamt wird ein umfassender
Überblick über diese neuartigen Methoden gegeben, der sowohl
Nukleinsäurebasierte Amplifikationsmethoden, Durchflusszytometrie,
Sequenzierungsansätze, spektroskopische Verfahren als auch Online-Sensorik
umfasst. Basierend auf der verfügbaren Literatur und eigenen Erfahrungen
konnten Anwendungsfelder identifiziert werden, für die der Einsatz bestimmter
Verfahren bereits heute einen deutlichen Mehrwert bietet.
Forschungsbericht W 202216 03/2024
246,10 €*
Im Projekt Neobiota, Forschungsbericht W 202216, wurde der
aktuelle Kenntnisstand zu gebietsfremden Arten in Gewässern in Deutschland
zusammengetragen und in dem vorliegenden Bericht zusammengefasst. In Gesprächen
mit Fachexperten und Wasserversorgern zeigte sich, dass derzeit vor allem Oberflächengewässer
durch gebietsfremde Arten betroffen sind. Hier haben sich insbesondere Muscheln
als besonders problematisch herausgestellt. So kommt es seit der Besiedlung des
Bodensees durch die Quagga-Muschel zu großen Problemen bei den Wasserwerken am
See, da diese Muscheln die Rohwasserleitungen und die nachfolgenden
Aufbereitungsanlagen be-siedeln. Die Beseitigung der Muscheln ist mit
aufwändigen Maßnahmen und zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe verbunden. Auch
Neophyten-Bewuchs kann zu Problemen für die Wasserversorgung führen, ebenso wie
Massenvermehrungen von potentiell toxinbildenden Algen oder Cyanobakterien, die
klimawandelbedingt zukünftig häufiger auftreten könnten.
DVGW-Information WASSER Nr. 97 06/2024
Preis ab:
39,92 €*
DVGW-Information Wasser Nr. 97 beschreibt Hintergrundinformationen über die desinfektionsrelevanten Parameter Chlorat,
Chlorit und halogenierte Essigsäuren, die seit der Veröffentlichung der TrinkwV 2023 mit einem Grenzwert belegt sind.Für die Desinfektion im Rahmen der zentralen Trinkwasseraufbereitung dürfen nur die gemäß Trinkwasserverordnung
zugelassenen Chemikalien und Desinfektionsverfahren eingesetzt werden. Wesentliche Kriterien, welche die Auswahl des geeigneten Desinfektionsverfahrens im konkreten Fall bestimmen, sind der
Anwendungsbereich bzw. die Einschränkungen der einzelnen Verfahren sowie die Bildung von Nebenprodukten als Folge der
Reaktionen der Desinfektionsmittel mit organischen und anorganischen Wasserinhaltsstoffen.Der Einsatz chlorhaltiger Chemikalien (Chlor, Hypochlorite und Chlordioxid) ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Desinfektionswirkung im Wasser über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann.Die Desinfektionswirkung ist abhängig von der Desinfektionsmitteldosis und dem Zehrungsverhalten des Wassers.
Wesentliche Einschränkungen für den Einsatz dieser Verfahren ergeben sich aus der Bildung von Nebenprodukten,
die von der Art und Konzentration der organischen Wasserinhaltsstoffe bestimmt werden, bzw. dem Bromidgehalt des Wassers.Beim Einsatz von Chlor und Hypochloriten ist zudem zu beachten, dass die desinfizierende Wirkung mit zunehmendem pH-Wert abnimmt.
Bereits geringe Ammoniumkonzentrationen können durch die Bildung von Chloraminen zu Geruchsbeeinträchtigungen führen und erhöhen den Chlorbedarf.
Forschungsbericht W 202303 11/2023
246,10 €*
Im Rahmen der vorliegenden Studie, DVGW-Forschungsbericht W 202303, bei der TZW und IWW Hand in Hand
arbeiteten, wurden Literaturinformationen und Erfahrungsberichte zu verfügbaren
Flockungsmitteln, zur Möglichkeit des Flockungsmittelrecyclings und zu
Alternativen des Flockungsverfahrens bei der Wasseraufbereitung
zusammengetragen und ausgewertet. Alternative Verfahren zur DOC- und
Partikelentfernung wurden der klassischen Flockung gegenübergestellt. Hierbei
wurden auch Informationen zum Energiebedarf und sofern verfügbar zum Fußabdruck erfasst. Auch internationale Lösungen flossen in die Literaturstudie ein.
Da Flockungsmittel in der gewünschten und gemäß TrinkwV geforderten Reinheit nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, handelt sich um eine akute Aufgabenstellung für viele Wasserversorgungsunternehmen.
Der Schwerpunkt der Recherche wurde insbesondere auf die DOC-Entfernung gelegt, da diese in der Regel für
extrem hohe Dosiermengen an Flockungsmitteln sorgt.
Das gesammelte Wissen wurde in übersichtlicher Form zusammengestellt und soll allen interessierten WVUs zur
Verfügung gestellt werden.
Die Studie enthält aussichtsreiche Handlungsoptionen mit
Beschreibung der notwendigen Umsetzungsvorgänge. Sie sollen den
Wasserversorgern helfen, für sich geeignete Lösungen zu finden.
W 347 Arbeitsblatt 11/2023
75,24 €*
DVGW-Arbeitsblatt W 347 zeigt die Anforderungen und
Prüfungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich auf.
Für Auskleidungen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen,
dürfen nach der Trinkwasserverordnung nur Werkstoffe und Materialien verwendet
werden, die im Kontakt mit Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen
abgeben, die höher sind als nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
unvermeidbar, oder den nach dieser Verordnung vorgesehenen Schutz der
menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern, oder den Geruch
oder den Geschmack des Wassers verändern.
W 347 legt Prüfungen und hygienische Anforderungen an
zementgebundene Werkstoffe fest, die im Kontakt mit Trinkwasser oder Rohwasser
für die Trinkwassergewinnung stehen.
Es dient außerdem dazu, die hygienische Eignung der in
Tabelle 1 aufgeführten zementgebundenen Werkstoffe für die Herstellung von
Materialien im Kontakt mit Trinkwasser entsprechend Trinkwasserverordnung für
den Bereich der Trinkwasseraufbereitung, -speicherung und -verteilung
nachzuweisen.
Die redaktionelle Anpassung des Arbeitsblattes wurde
notwendig, um Ergänzungen zur Positivliste des Umweltbundesamtes zu
berücksichtigen.
Forschungsbericht W 202219 09/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens W 202219 besteht in
der Zusammenstellung des Expertenwissens bezüglich der Rohstoff- und
Energiesituation bei der Aktivkohleherstellung, der Eigenschaften der
unterschiedlichen Aktivkohlen sowie den Erfahrungen im Bereich der Optimierung
des Aktivkohleeinsatzes bei Wasserversorgungsunternehmen. W 202219 zeigt Alternativen
zum Einsatz von Aktivkohlen auf und bewertet diese.
Lieferengpässe im Jahr 2022 waren darauf zurückzuführen,
dass pandemiebedingt die Lieferkette nur eingeschränkt funktionierte. Aktuell
hat sich diesbezüglich die Situation wieder entspannt. Doch auch zukünftig muss
mit Krisensituationen gerechnet werden. Daher ermittelt dieses
Forschungsvorhaben W 202219 Grundlagen, wie auf solche Krisen reagiert werden
kann.
Im Zusammenhang mit einem resilienten Umgang von Aktivkohle
ist ein erster Schritt die Prüfung von Maßnahmen für eine Minimierung des
Aktivkohlebedarfs, wie sie in W 202219 zusammengestellt sind. Dies beinhaltet
auch die Möglichkeit der Reaktivierung.
Forschungsbericht W 201904 06/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Der globale Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf
viele Bereiche der Umwelt, wobei die Zunahme von Hitzeperioden in den
Sommermonaten, die zu einer zunehmenden Erwärmung der Umwelt führen, eine
besonders relevante Auswirkung darstellen. Von dieser Erwärmung sind auch die
Bodenzonen betroffen, in denen die Trinkwasserleitungen verlegt sind. Inwieweit
das Trinkwasser in Trinkwasserrohrnetzen in Deutschland von einer Erwärmung
betroffen ist, wurde bisher nicht wissenschaftlich untersucht.
Der Ansatz des Forschungsprojektes W 201904 bestand darin,
die Prozesse der Erwärmung zu untersuchen und für die Praxis Ansätze zur
Bewertung der Temperatursituation im Trinkwasserrohrnetz zu entwickeln. Das
übergeordnete Ziel bestand darin, Grundlagen für verschiedene Handlungsfelder
zum Umgang mit der Problematik hoher Wassertemperaturen im Trinkwasserrohrnetz
zu erarbeiten.
Zur Berechnung der Bodentemperaturentwicklung wurde ein
numerisches Bodenmodell entwickelt, mit dem auch der Effekt weiterer
Wärmequelle berücksichtigt werden kann. Ein einfacher Ansatz zur Abschätzung
des Erwärmungsrisikos im Trinkwasserrohrnetz ist die Verwendung von
Satellitendaten und die Einteilung der Netzbereiche entsprechend angenommener
hydraulischer Bedingungen.
Im Ergebnis des entwickelten Prozessverständnisses lassen
sich längerfristige Maßnahmen zur nachhaltigen Beherrschung der
Temperaturproblematik ableiten. Die entwickelten Ansätze können genutzt werden,
um zu prüfen, welche Maßnahmen in der Praxis unter welchen Rand-bedingungen
tatsächlich nachhaltig sind. Für das Regelwerk W397 leitet sich ein Überarbeitungsbedarf,
insbesondere für die Annahme der charakteristischen Sommertemperatur, ab.
DIN 3630 Entwurf 03/2024
56,60 €*
DIN 3630 Entwurf ist für Absperrarmaturen, Rückflussverhinderer, Be- und Entlüftungsventile und Regelarmaturen für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen anzuwenden.
Forschungsbericht W 202012 06/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
In der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie (EU-DWD) wurde ein
risikobasierter Ansatz (risk based approach) aufgenommen, in dem u. a.
vorgesehen ist, das Rohwasser und bei Überschreiten des Referenzwertes von 50
PFU / 100 mL auch das Wasser innerhalb der Aufbereitung auf „somatische
Coliphagen“ zur Erfassung des mikrobiellen Risikos insbesondere durch fäkale
virale Krankheitserreger zu untersuchen. Der Parameter „somatische Coliphagen“
dient zur Verifizierung der Entfernungswirksamkeit der Aufbereitung für Viren
bzw. Partikel im Größenbereich von Viren.
Im Rahmen dieses Vorhabens W 202012 wurden Rohwässer mit
unterschiedlich starkem Einfluss von Oberflächenwasser in Form von Flusswasser
ausgewählt (direkte Aufbereitung (< 1 h), kurze Bodenpassage (5 d), lange
Uferfiltration (50 d) und sehr lange Uferfiltration (> 100d)), in denen
spezifische Untersuchungen auf bakterielle und virale Krankheitserreger mit
kulturellen und PCR-Verfahren sowie Indikatoren durchgeführt wurden. Als
Oberflächenwasser wurden jeweils Flusswässer gewählt, da nur diese eine
ausreichend hohe mikrobiologische Ausgangsbelastung enthalten, um einen
Log-Rückhalt durch Partikelentfernung berechnen zu können.
Durch die Untersuchungen von vier Wasserversorgungen, die
Flusswasser zur Trinkwasser-aufbereitung nutzen, konnten Rohwässer mit
unterschiedlichen Aufenthaltszeiten in der ersten partikelentfernenden Stufe
(in der Wasseraufbereitung bei direkter Flusswasseraufbereitung und im
Untergrund bei Bodenfiltraten und Uferfiltraten) betrachtet werden.
In drei der vier Flusswässer lagen die Mittelwerte der
Konzentrationen der somatischen Coliphagen oberhalb des Referenzwertes von 50
PFU / 100 mL, die gemäß EU-DWD eine Bewertung der Wirksamkeit der
Aufbereitungsverfahren erforderlich machen.
Eine starke Oberflächenwasserbeeinflussung wurde bei den
Wasserversorgungsunternehmen mit kurzen Fließzeiten (< 1h (direkte
Aufbereitung), 5 d Bodenpassage) festgestellt, eine sehr geringe bzw. kaum
nachweisbare Oberflächenwasserbeeinflussung bei den Uferfiltraten mit langer
Fließzeit (50 d, > 100 d).
Diese Beeinflussung ließ sich einerseits aus den
historischen Daten erkennen, da hier bei den stark beeinflussten Wässern die
Häufigkeit von Positivbefunden coliformer Bakterien in den Rohwässern noch fast
100 % beträgt, während bei den kaum beeinflussten Rohwässern mit den langen
Bodenpassagen die Häufigkeit unter 1% lag. Andererseits zeigten auch die erreichbaren
Rückhalte und auch die quantitative mikrobielle Risikobewertung, dass diese für
die langen Aufenthaltszeiten im Untergrund ein mögliches Gesundheitsziel von
10-4 Infektionen pro Person und Jahr erreichen.
Eine Untersuchung auf somatische Coliphagen zur
Risikobewertung ist bei den hochbelasteten Flusswässern auf jeden Fall
sinnvoll, bei den Boden- oder Uferfiltraten dagegen nur bei solchen mit kurzen
Fließzeiten im Untergrund.
Forschungsbericht W 202126 03/2023 -PDF-Datei-
246,10 €*
Die QUOVADIS-LAB-Studie konnte ein sehr positives Bild der
aktuellen Trinkwasseranalytik und deren Entwicklung darstellen. Die Hersteller
der Analysengeräte greifen mit ihrem Unternehmergeist dynamisch Tendenzen und
Bedarfe am Markt auf und setzen sie in Kooperation mit ihren Kunden in gute
Lösungen um. Der Treiber „Gesetzgebung“ wird sowohl von Wasser-versorgern als auch
von Herstellern als positiv und innovationsfördernd angesehen. Schwerpunkte
der Entwicklung sehen die Hersteller eher bei den Generalthemen Automatisierung
und Digitalisierung, während Wasserversorger stärker den Fokus auf den Ausbau
der Spurenstoffanalytik sowie den modernen mikrobiologischen Ansätzen und der
online-Sensorik sehen.
In der mikrobiologischen Analytik sollten die
molekularbiologischen Verfahren, mit denen bakterielle Kontaminationen
schneller und effektiver erfasst werden können als mit klassischen
Kulturverfahren, gefördert und für die Überwachung hoffähig gemacht werden.
Für die chemische Analytik ist zu erwarten, dass zukünftig
vermehrt Analyseverfahren gebraucht werden, die mit Screening-Ansätzen noch
mehr Stoffe in sehr niedrigen Konzentrati-onen erfassen können. Die aktuell
erreichbaren Bestimmungsgrenzen in der Region von 1-10 ng/l scheinen dabei als
ausreichend. Es wurde gezeigt, dass die verfügbaren Budgets und Ressourcen
besser in eine breitere statt eine „tiefere“ Analytik investiert werden
sollten.
Die Target-Analytik behält aller Voraussicht nach weiterhin einen
sehr hohen Stellenwert. Parallel dazu scheint es sinnvoll zu sein, dass
Screening-Verfahren weiter vorangebracht werden, so dass die Vorteile beider
Ansätze sinnvoll vereint werden.
Die Mikroplastik-Analytik im Trinkwasser ist vermutlich für
die Routineüberwachung nicht erforderlich.
Es wäre wünschenswert, im Trinkwassersektor mehr auf eine
ganzheitliche Betrachtungs-weise der Wirkung des Trinkwassers auf den Menschen
zu setzen. Dafür ist die wirkungsbe-zogene Analytik (WBA) gut geeignet.
Mit der neuen Trinkwasserverordnung wird der Weg einer
amtlichen betrieblichen online-Überwachung bestimmter Parameter frei gemacht.
Eine ganz wesentliche Entwicklung wird die Veränderung des
Einsatzes von Analytik im Umfeld des verpflichtenden Risikomanagements nach
TrinkwV darstellen. Mit dem Risikoma-nagement werden flexible neue oder
veränderte Ansätze gebraucht werden. Hierbei sind Kreativität und Innovationen
gefragt.
Die Flut an Daten aus allen Teilbereichen der Analytik muss
durch eine angemessene und zielgruppenorientierte Risikokommunikation begleitet
werden. Dieser Aspekt ist zu intensivieren, da es neben der Erfüllung von
Überwachungspflichten darum geht, dass die Ergebnisse verständlich erklärt und
deren Bedeutung transparent gemacht und eingeordnet wird.
Im Projekt zeigte sich auch deutlich, dass alle Bereiche der
Analytik von einer weiteren Digitalisierung und Automatisierung profitieren
würden.
Begleitend sollte auch die zukünftig zunehmende Bedeutung
der „grünen analytischen Chemie“ im Blick behalten werden. Analytische
Verfahren im Umweltbereich sollten möglichst umwelt- und ressourcenschonend
sein.
DIN 19643-4 06/2023 - PDF-Datei
85,30 €*
Dieses Dokument DIN 19643-4 ist in Verbindung mit E DIN
19643-1 für die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser durch
Verfahrenskombinationen mit Ultrafiltration anwendbar. Es ist auch für
Therapiebecken anwendbar.
DIN 19643-3 06/2023
128,50 €*
Dieses Dokument DIN 19643-3 beschreibt die Aufbereitung von
Schwimm- und Badebeckenwasser durch Verfahrenskombinationen mit Ozonung und Chlorung
in Verbindung mit DIN 19643-1. Es ist auch für Therapiebecken anwendbar.
DIN 19643-2 06/2023
Preis ab:
99,10 €*
Dieses Dokument DIN 19643-2 ist in Verbindung mit
DIN 19643-1 für die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser durch
Verfahrenskombinationen mit Festbett- und Anschwemmfiltern anzuwenden. Es ist
nicht für Therapiebecken anzuwenden.
DIN 19643-1 06/2023 - PDF-Datei
163,40 €*
Dieses Dokument DIN 19643-1 legt allgemeine Anforderungen an
die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser fest. Es ist anzuwenden für
Wasser einschließlich Meerwasser, Mineralwasser, Heilwasser, Sole (auch
künstlich hergestellte) und Thermalwasser in Schwimm- und Badebeckenanlagen mit
öffentlicher Nutzung einschließlich solcher Einrichtungen, die von einem
größeren und wechselnden Personenkreis genutzt werden.