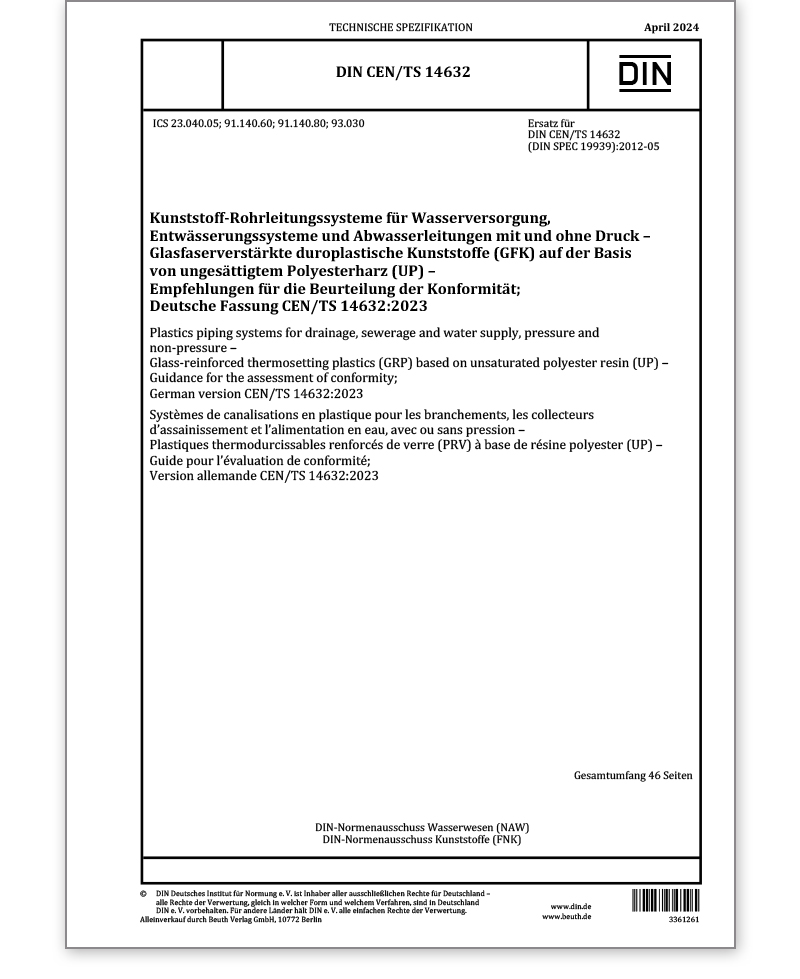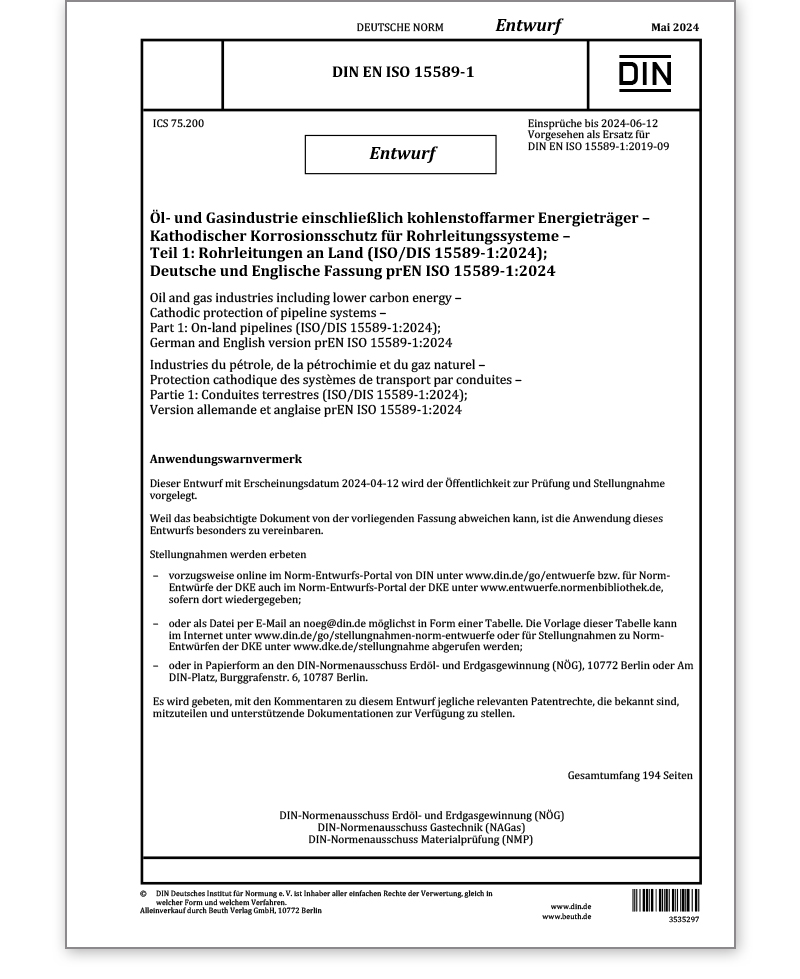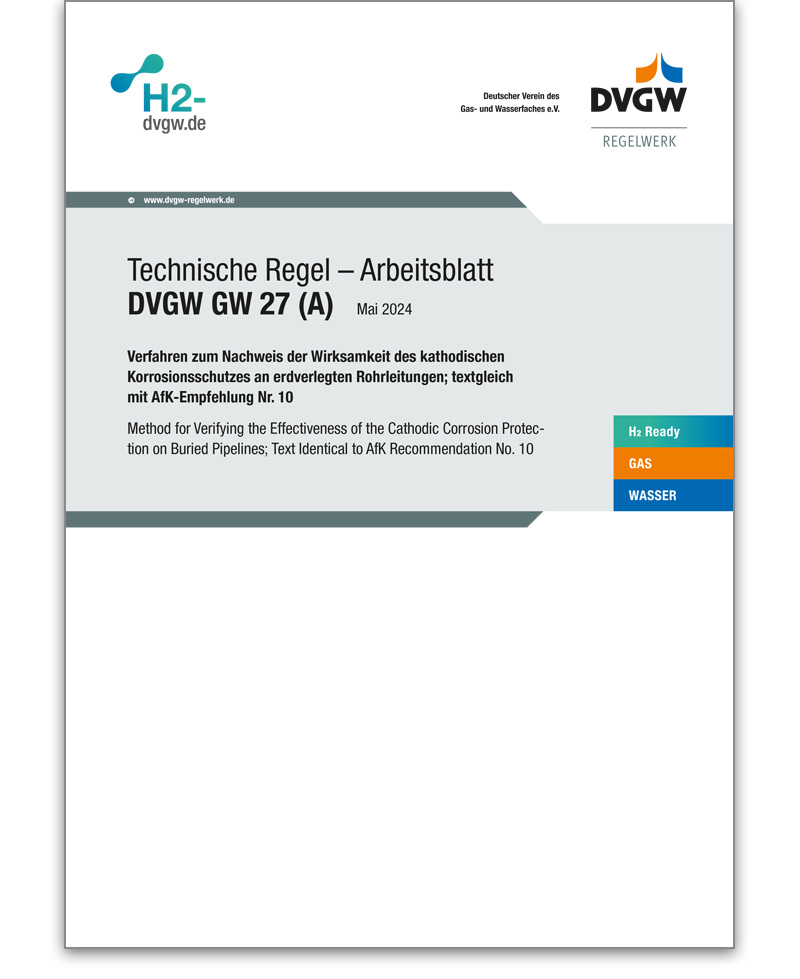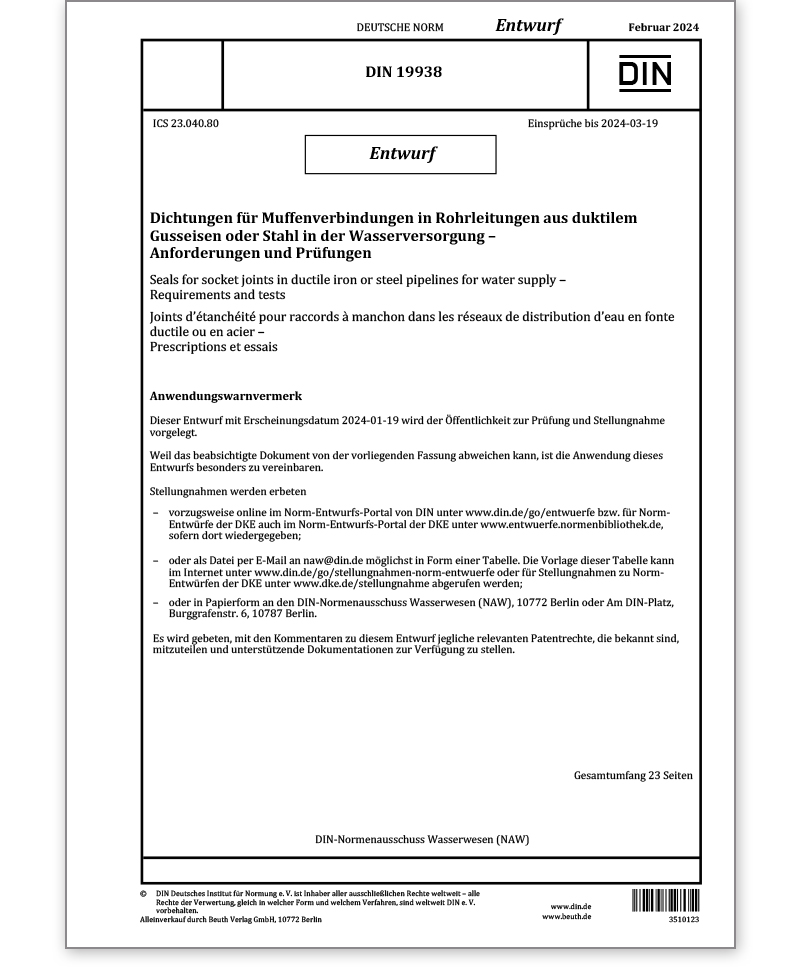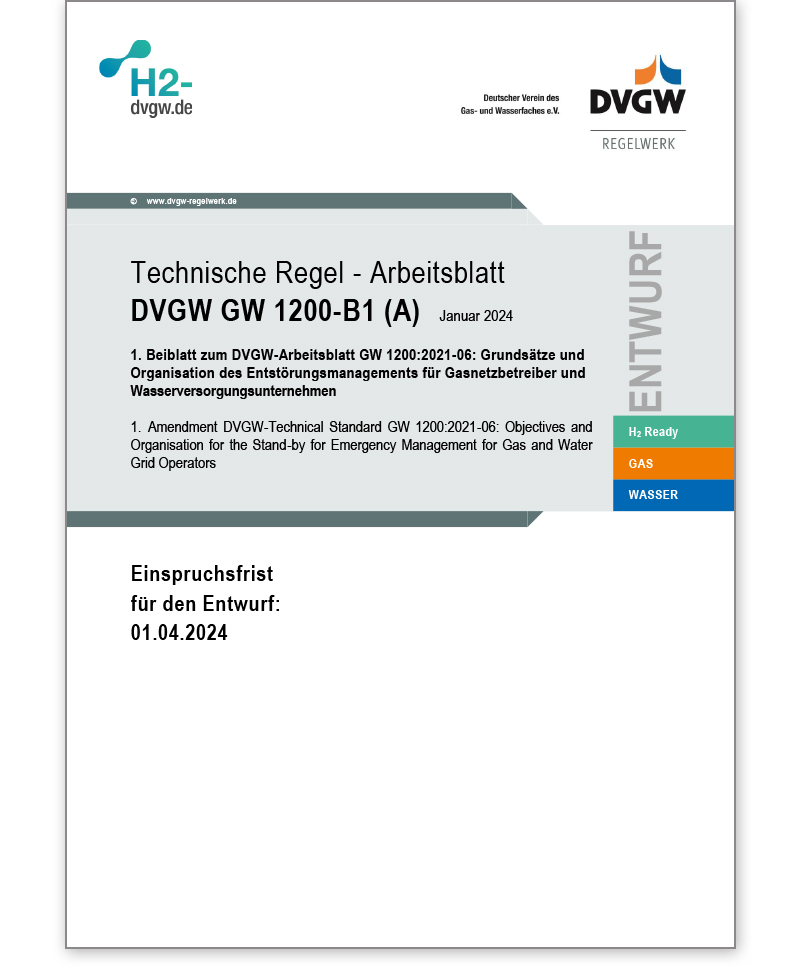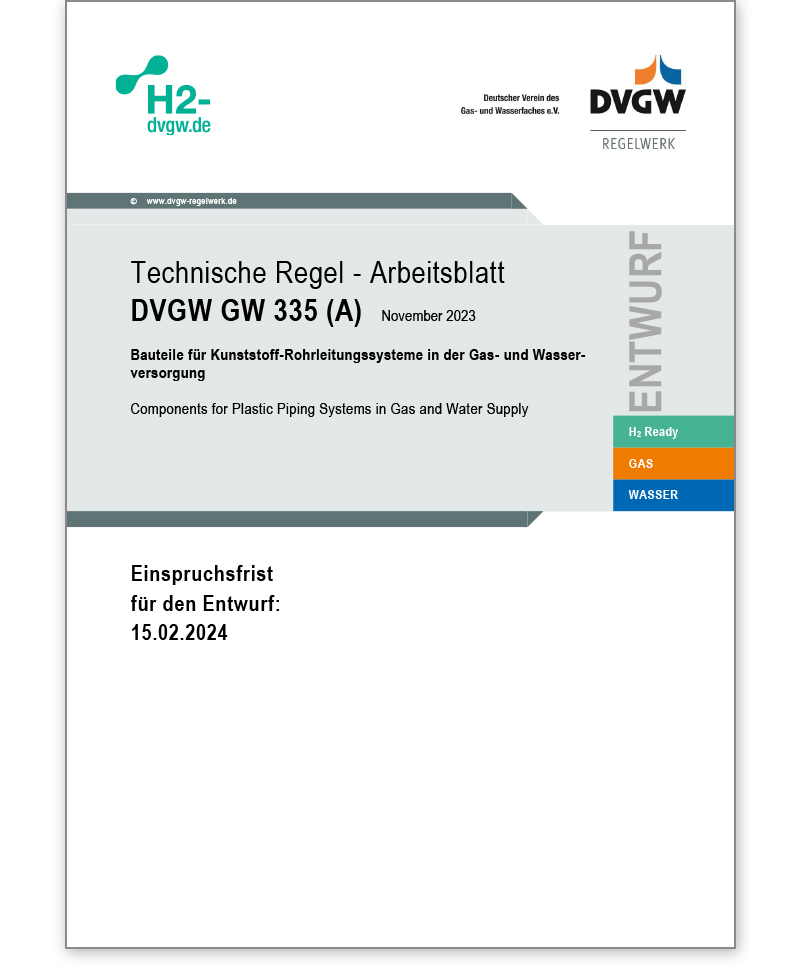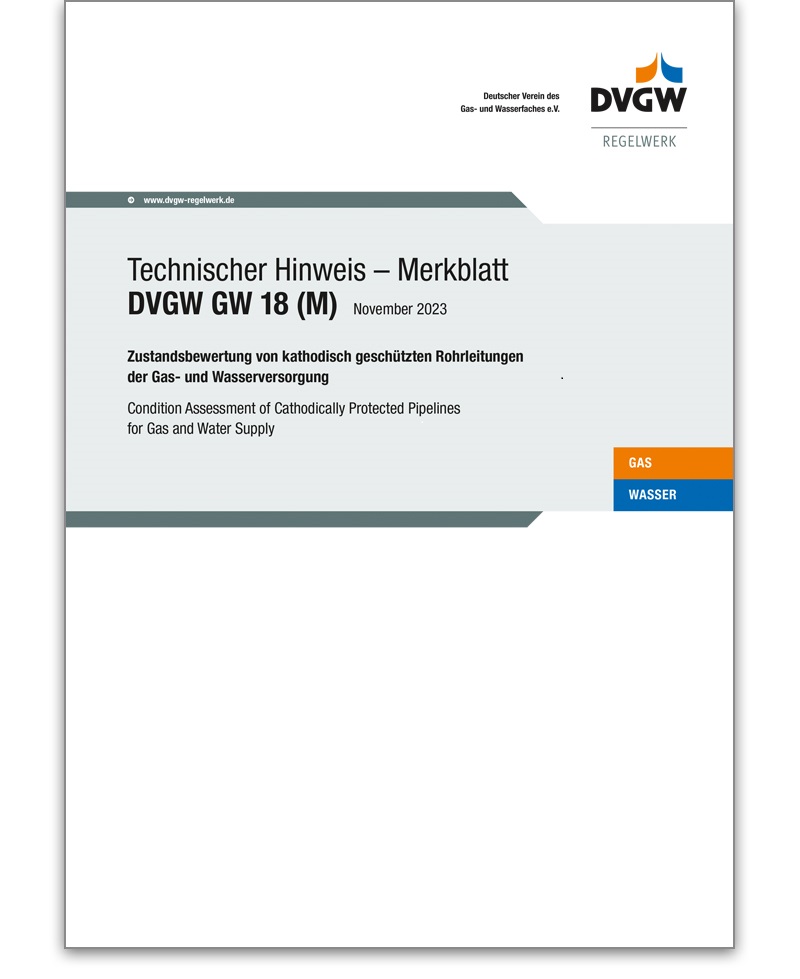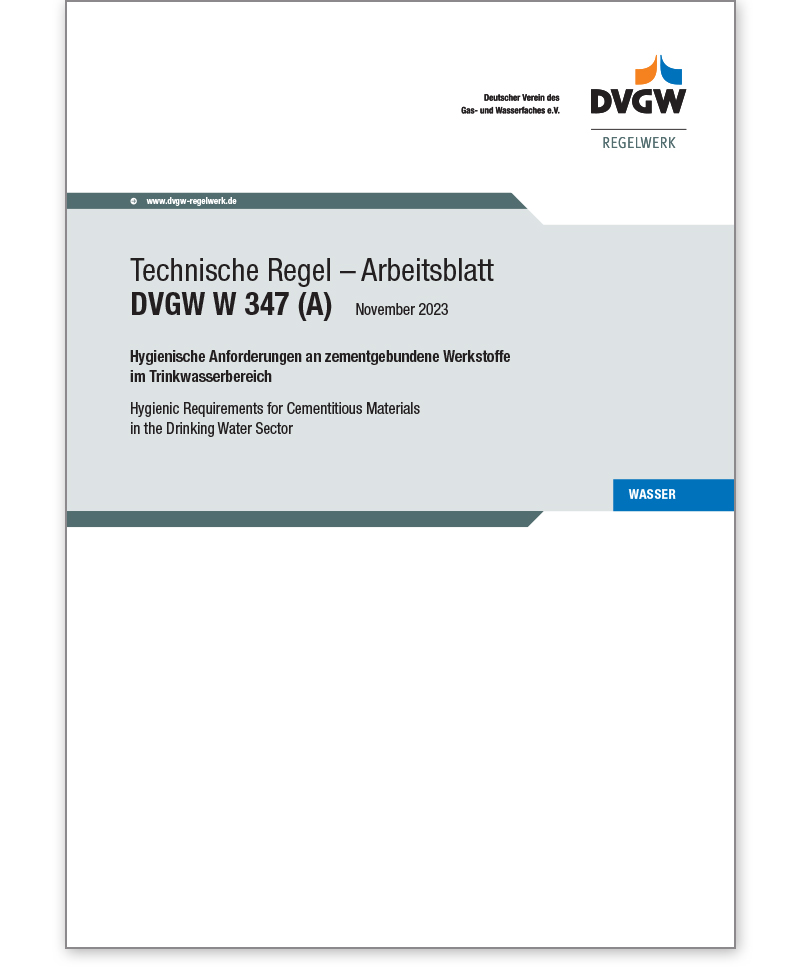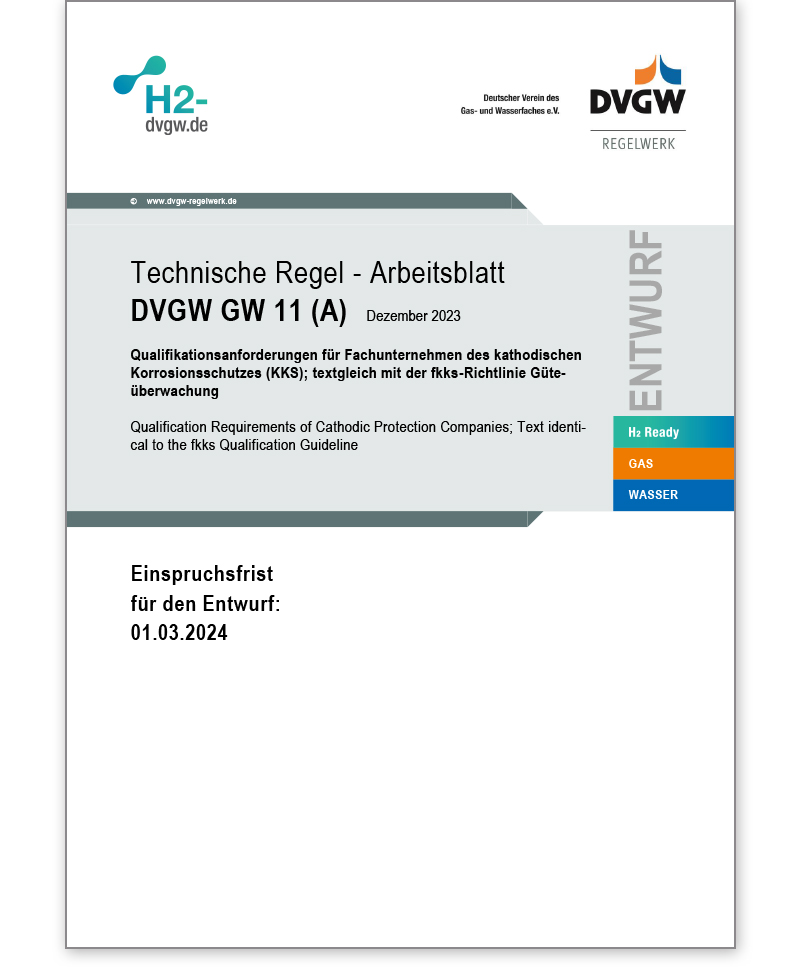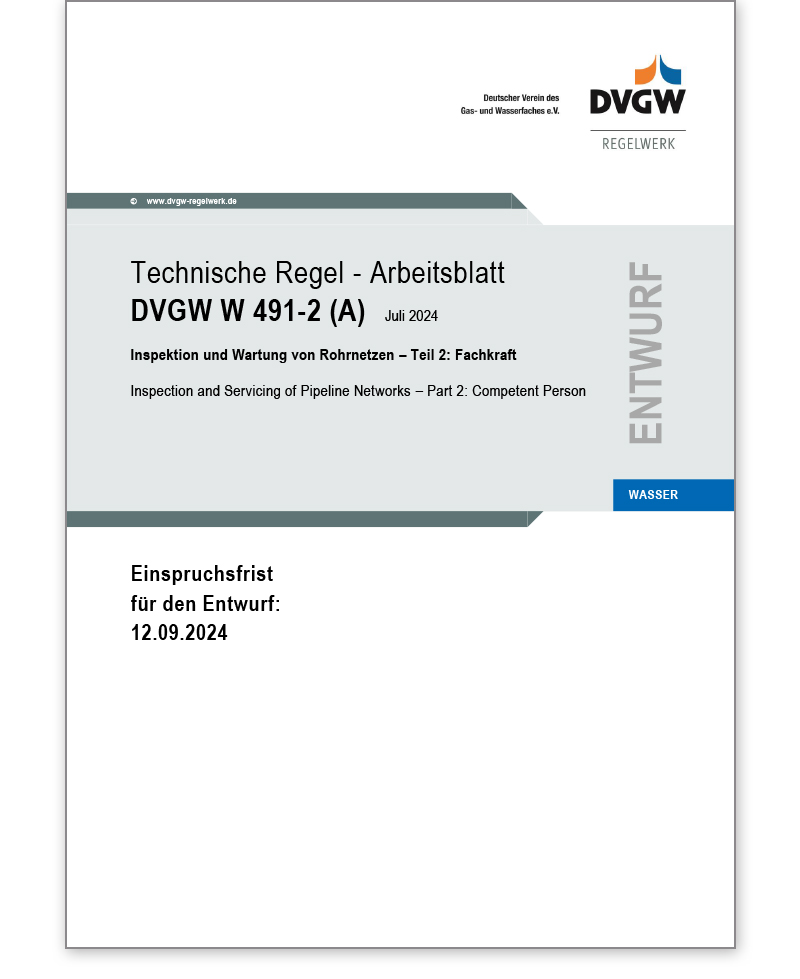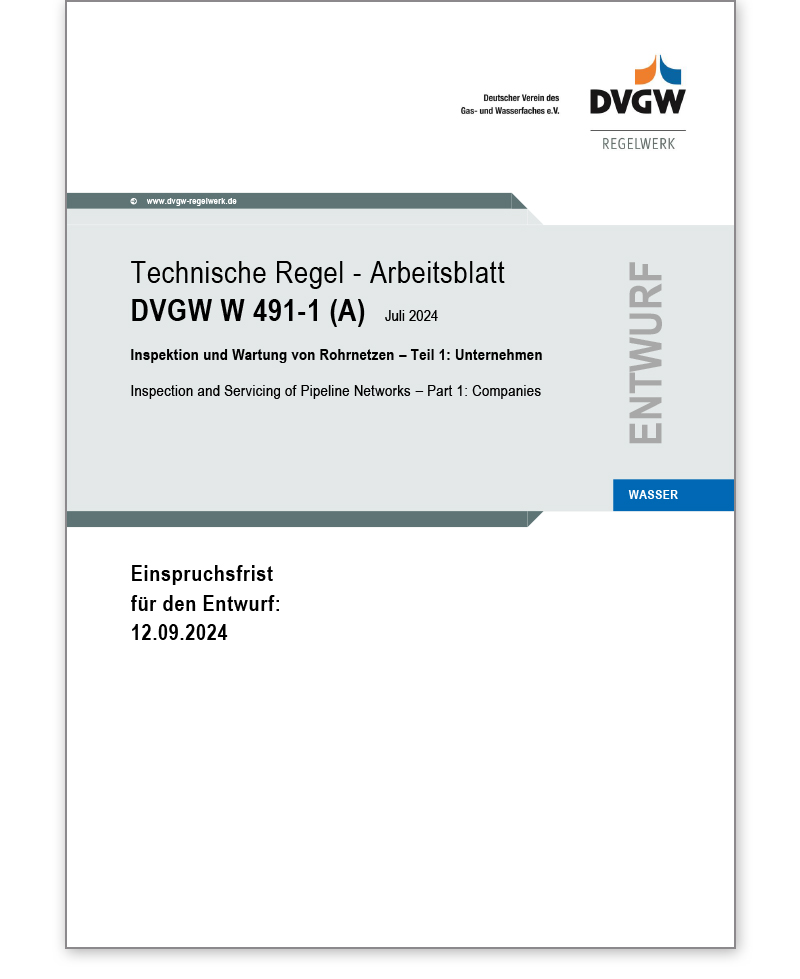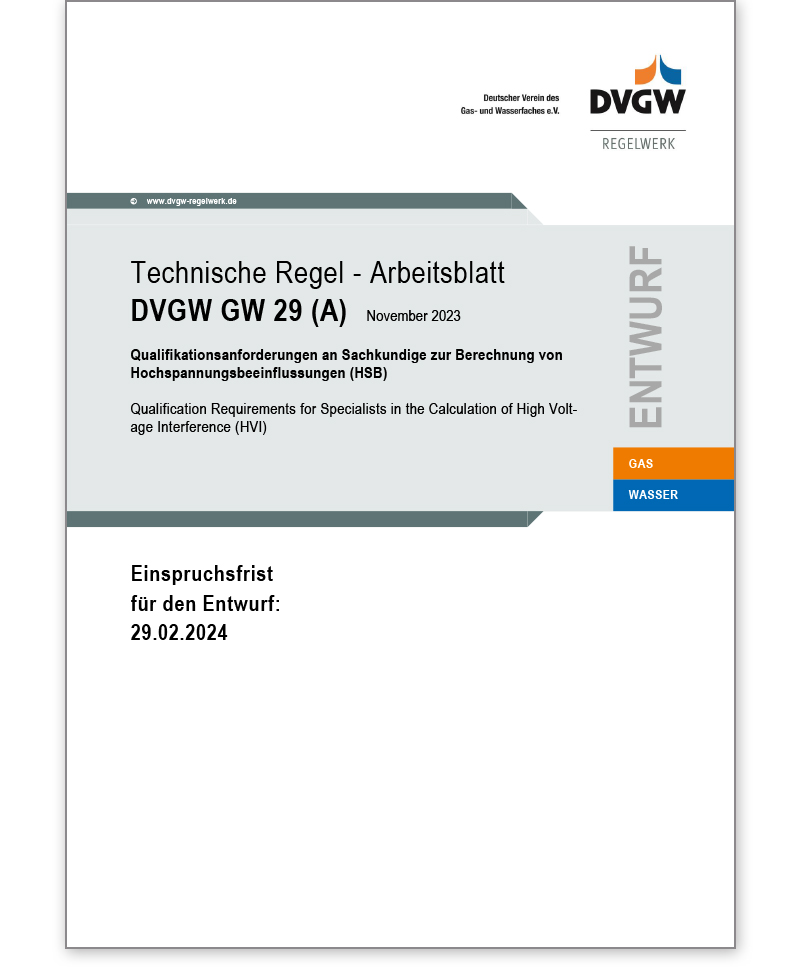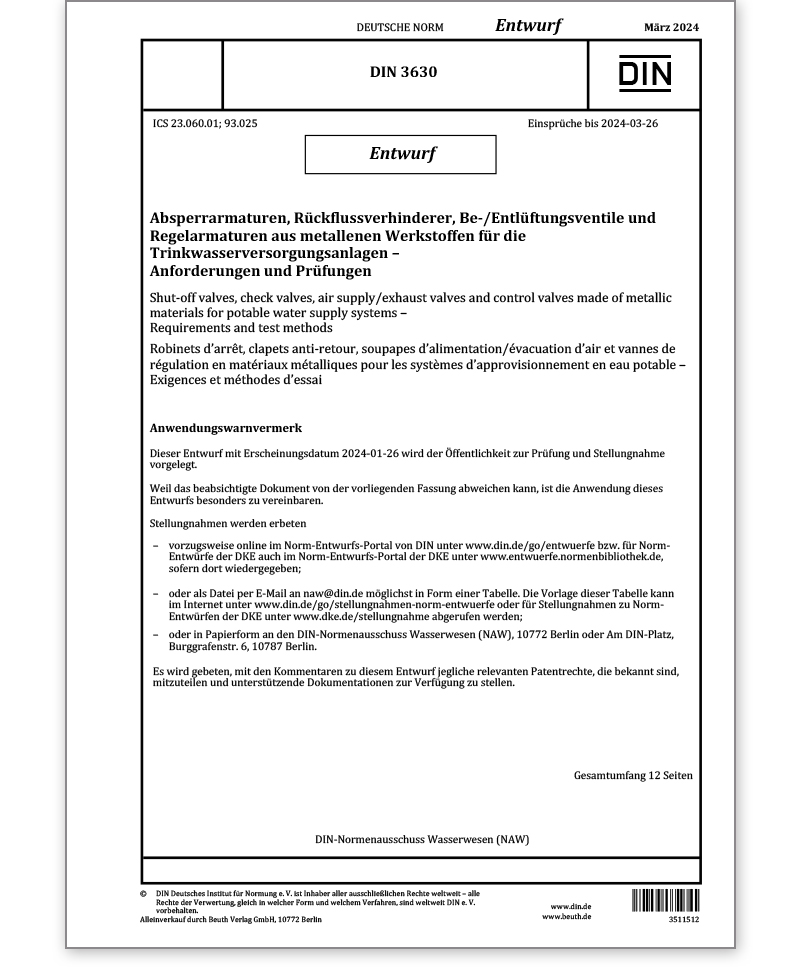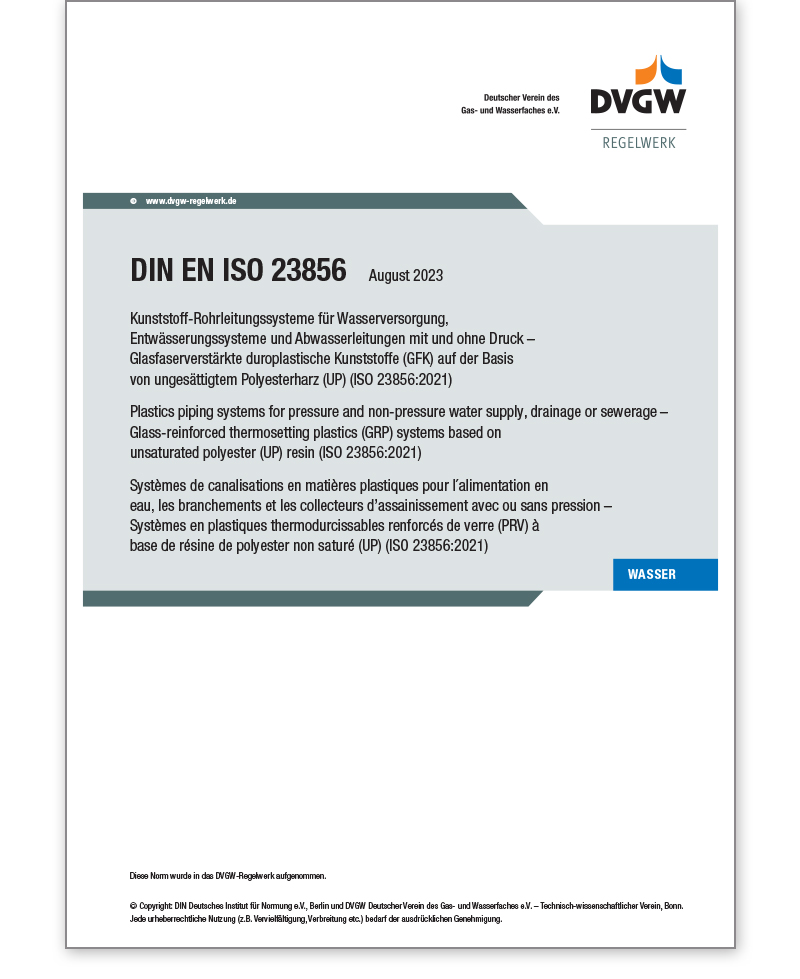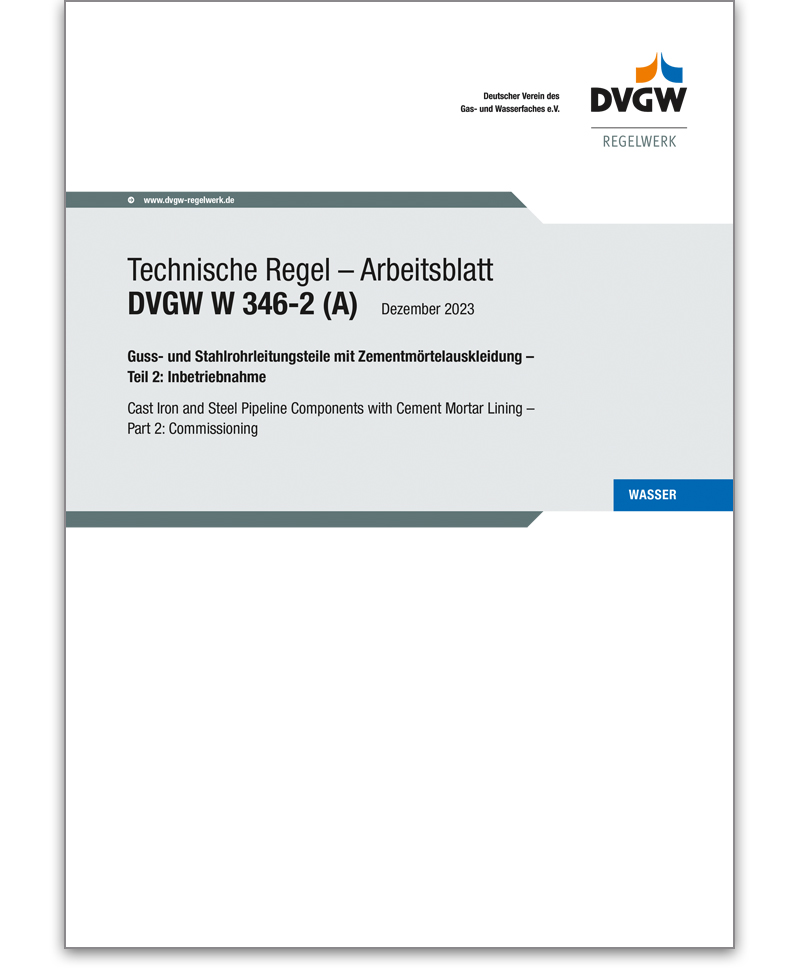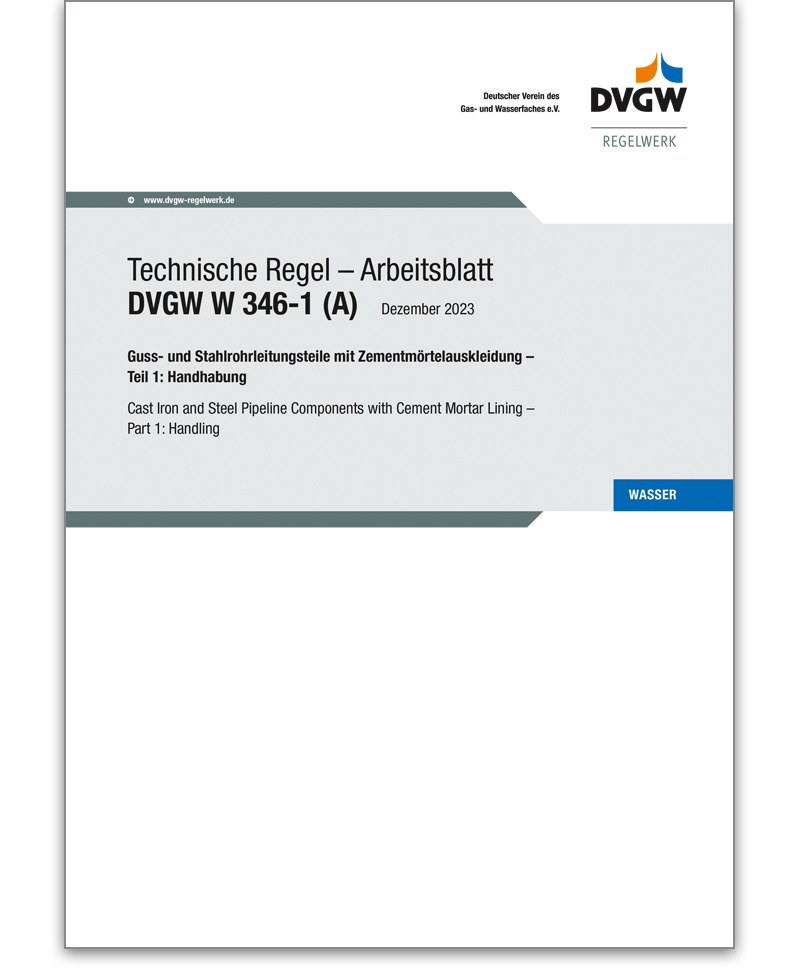Filter
–
Wasser Speicherung
Alles zur Infrastruktur Wasser bieten die Regelwerke und Normen dieser Rubrik. Themen sind u.a. Wasserverteilung und Rohrnetze, Wasserspeicherung, Messwesen, Löschwasser.
DIN CEN/TS 14632 04/2024
Preis ab:
98,90 €*
Dieses Dokument DIN CEN/TS
14632 enthält Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität von
Rohrleitungsteilen und Bauteilkombinationen aus glasfaserverstärkten
duroplastischen Kunststoffen auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz
(GFK-UP) nach EN ISO 23856, ISO 25780 und ISO 16611, die als Bestandteil des
Qualitätsmanagementsystems im Qualitätssicherungsplan des Herstellers und für
die Einführung von Drittstellenzertifizierungsverfahren vorgesehen sind.
DIN CEN/TS enthält
auch Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität von Einsteig- und
Kontrollschächten aus GFK-UP (siehe EN15383 für weitere Angaben). Steigrohre
und Schachteinheiten werden aus Rohren (siehe ENISO23856) gefertigt. Zusätzliche
Angaben, die zur Beurteilung der Konformität von Einsteig- und Kontrollschächten
benötigt werden, sind in Anhang F enthalten.
DIN EN ISO 15589-1 Entwurf 05/2024
Preis ab:
197,50 €*
DIN EN ISO 15589-1 Entwurf legt Anforderungen
fest und gibt Empfehlungen für die Untersuchungen vor der Installation, die
Planung, die Werkstoffe, die Ausrüstung, die Installation, die Inbetriebnahme,
den Betrieb, die Inspektion und die Instandhaltung von kathodischen Schutzsystemen
für Rohrleitungen an Land. Rohrleitungen an Land sind in ISO 13623 oder EN
14161 für die Erdöl-, Petrochemie- und Erdgasindustrie definiert. Sie werden
auch in EN 1594, EN 12007-1 und EN 12007-3 beschrieben, die von der
Gasversorgungsindustrie in Europa verwendet werden.
Dieser Teil von ISO 15589 ist anwendbar auf
Rohrleitungen an Land und Rohrleitungssysteme, die in anderen Industriezweigen
verwendet werden und andere Medien transportieren, wie industrielle Gase,
Wässer oder Schlämme.
GW 27 Arbeitsblatt 05/2024
Preis ab:
110,68 €*
DVGW-Arbeitsblatt GW 27 gilt für erdverlegte kathodisch geschützte Rohrleitungen aus Stahl. Nach DIN EN ISO 15589-1 muss bei wirksamem kathodischen Korrosionsschutz das Schutzpotential an jeder Fehlstelle der Umhüllung
einer kathodisch geschützten Rohrleitung erreicht sein. Einzelne Messverfahren sind in DIN EN 13509 und auch in DIN EN ISO 15589-1 skizziert.DVGW-Arbeitsblatt GW 27 greift diese Messverfahren auf und ergänzt sie z. B. mit Betrachtungen zum möglichen Messfehler.
Darüber hinaus beschreibt es weitere Messverfahren, mit denen der Nachweis des Schutzkriteriums im Sinne von DIN EN ISO 15589-1 erfolgen kann.GW 27 gibt darüber hinaus Hinweise über die Zweckmäßigkeit der Anwendung der einzelnen Verfahren unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
DIN 19938 Entwurf 02/2024
103,11 €*
Dieses Dokument DIN 19938 Entwurf legt Anforderungen und
Prüfungen an Dichtungen für Muffenverbindungen in Rohrleitungen aus duktilem
Gusseisen oder Stahl in der Trinkwasserversorgung fest.
DIN 19938 Entwurf ist anwendbar für Anforderungen und
Prüfungen bezüglich der Haltesegmente, die in Dichtungen für
längskraftschlüssige Verbindungen enthalten sind.
GW 1200-B1 Entwurf Arbeitsblatt 01/2024
Preis ab:
39,92 €*
Das DVGW-Arbeitsblatt GW 1200-B1 Entwurf ändert das DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 in den Abschnitten 1, 2 und 3.Mit dem DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 06/2021 wurde ein grundsätzlicher Rahmen geschaffen, der die wesentlichen Anforderungen an das Entstörungsmanagement von Gasnetzbetreibern und Wasserversorgungsunternehmen festlegt.
GW 335 Entwurf Arbeitsblatt 11/2023
Preis ab:
62,03 €*
Dieses Arbeitsblatt GW 335 Entwurf gilt für Bauteile von Kunststoff-Rohrleitungssystemen im Bereich der öffentlichen Gas- und Wasserversorgung.
GW 18 Merkblatt 11/2023
Preis ab:
79,28 €*
Dieses Merkblatt GW 18 gilt für kathodisch geschützte Rohrleitungen in der Gas- und Wasserversorgung. Es beschreibt die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau einer Zustandsbewertung auf der Basis von KKS-Messdaten und gibt Hinweise darauf, wie diese bei der Umsetzung einer zustandsorientierten Instandhaltungsstrategie verwendet werden kann. Grundvoraussetzung für die Anwendung des KKS im Rahmen einer zustandsorientierten Instandhaltung für Rohrleitungen ist ein wirksamer passiver und aktiver Korrosionsschutz.KKS-Messdaten können keine Auskunft über Veränderungen des Grundwerkstoffes Stahl geben. Undichtheiten an Armaturen, mögliche Schäden, z. B. durch unsachgemäß ausgeführte Schweißnähte und Nachumhüllungen sowie Produktionsfehler können deshalb durch KKS-Messdaten nicht nachgewiesen werden. Derartige Schadensfälle sind beispielsweise im Rahmen einer Schadensstatistik nach den DVGW-Arbeitsblättern W 402 und G 402 festzuhalten und auszuwerten. Die Integration der Zustandsbewertung auf Basis von KKS-Messdaten nach diesem Merkblatt in andere Zustandsbewertungssysteme, wie beispielsweise nach den DVGW-Merkblättern W 403 und G 403, ist dabei möglich.
W 347 Arbeitsblatt 11/2023
75,24 €*
DVGW-Arbeitsblatt W 347 zeigt die Anforderungen und
Prüfungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich auf.
Für Auskleidungen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen,
dürfen nach der Trinkwasserverordnung nur Werkstoffe und Materialien verwendet
werden, die im Kontakt mit Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen
abgeben, die höher sind als nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
unvermeidbar, oder den nach dieser Verordnung vorgesehenen Schutz der
menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern, oder den Geruch
oder den Geschmack des Wassers verändern.
W 347 legt Prüfungen und hygienische Anforderungen an
zementgebundene Werkstoffe fest, die im Kontakt mit Trinkwasser oder Rohwasser
für die Trinkwassergewinnung stehen.
Es dient außerdem dazu, die hygienische Eignung der in
Tabelle 1 aufgeführten zementgebundenen Werkstoffe für die Herstellung von
Materialien im Kontakt mit Trinkwasser entsprechend Trinkwasserverordnung für
den Bereich der Trinkwasseraufbereitung, -speicherung und -verteilung
nachzuweisen.
Die redaktionelle Anpassung des Arbeitsblattes wurde
notwendig, um Ergänzungen zur Positivliste des Umweltbundesamtes zu
berücksichtigen.
GW 11 Entwurf Arbeitsblatt 12/2023
62,03 €*
Das Arbeitsblatt GW 11 Entwurf gilt für Fachunternehmen des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS). Es beschreibt die formalen, personellen und sachlichen Anforderungen sowie die Vorgaben zur Prüfung und Überwachung solcher Unternehmen.Dieser Entwurf GW 11 ist als Ergänzung zur DIN EN ISO 15257 zu sehen. Im Rahmen der Präqualifikation, gemäß Vergaberichtlinien, ist die Leistungsfähigkeit der Fachfirmen zu überprüfen. Dies wird durch die Anwendung der DIN EN ISO 15257 allein nicht sichergestellt. Ebenso werden Fachkennt-nisse des nationalen Regelwerkes durch die DIN EN ISO 15257 nicht berücksichtigt.
W 491-2 Entwurf Arbeitsblatt 07/2024
Preis ab:
39,92 €*
Dieses Arbeitsblatt W 491-2 Entwurf aktualisiert das Arbeitsblatt W 491, in Bezug auf die
Qualifikation von Fachkräften, die Rohrnetze inspizieren und warten und damit
die Leistungstragenden von Unternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt W 491-1 bilden.
W 491-1 Entwurf Arbeitsblatt 07/2024
Preis ab:
39,92 €*
Dieses Arbeitsblatt W 491-1 Entwurf aktualisiert das Arbeitsblatt W 491 in Bezug auf die
formalen, personellen und sachlichen Anforderungen für Unternehmen, die
Rohrnetze inspizieren und warten, sowie die zugehörigen Prüfungen. DVGW W 491-1 Entwurf gilt für Unternehmen, die Objektgruppen (IW1, IW2, IW3) in Rohrnetzen nach DVGW
W 400-3 (A) inspizieren und warten.
GW 29 Entwurf Arbeitsblatt 11/2023
Preis ab:
39,92 €*
Dieses Arbeitsblatt GW 29 Entwurf legt
Qualifikationsanforderungen an Sachkundige für Hochspannungsbeeinflussung fest,
deren Einsatz nach dem DVGW-Regelwerk und der DGUV Information (z. B. 203-001,
203-002) der Berufsgenossenschaft gefordert wird.Das vorliegende Dokument definiert die Personenqualifikation
für Sachkundige zur Berechnung von Hochspannungsbeeinflussung sowie den
Kriterien die notwendig sind, um diese Qualifikation zu erreichen.
Qualifizierte Sachkundige Hochspannungsbeeinflussung (SK HSB) besitzen einen
ganzheitlichen Über-blick über das Thema der Hochspannungsbeeinflussungsberechnung
und die Umsetzung und Umsetzbarkeit von ggf. notwendigen Folgemaßnahmen wie z.
B. Erdungsanlagen. Sie haben Kenntnis der geltenden Regelwerke, können
Beeinflussungssituationen nachvollziehen und einordnen und sind in der Lage,
die Umgebungsbedingungen in Zusammenhang mit gültigem Regelwerk nach
DVGW-Arbeitsblatt GW 22 und anderen dem Stand der Technik entsprechenden
Regelwerken zu bringen. Auch sind dem SK HSB organisatorische Maßnahmen und die
möglichen Anwendungsfälle bekannt, mit allen Vorteilen und Risiken. Er ist in
der Lage, potenziell gefährdete Bereiche einer Rohrleitung rechnerisch zu
ermitteln und einzugrenzen.
DIN 3630 Entwurf 03/2024
56,60 €*
DIN 3630 Entwurf ist für Absperrarmaturen, Rückflussverhinderer, Be- und Entlüftungsventile und Regelarmaturen für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen anzuwenden.
DIN EN ISO 23856 08/2023
204,59 €*
DIN EN ISO 23856 wurde durch die Zusammenführung von ISO
10639, ISO 10467, EN 1796 und EN 14364 erstellt. Da diese Normen nahezu
identisch waren, abgesehen von den Anforderungen an die chemische Beständigkeit
von Abwasserleitungen und davon, dass es keine negativen Auswirkungen auf die
Wasserqualität durch Trinkwasserleitungen gibt, wurde die Auffassung vertreten,
dass es für Anwender von Vorteil wäre, wenn sie unabhängig von Anwendung und
Region nur ein Dokument konsultieren bräuchten.
Dieses Dokument legt die Eigenschaften von
Rohrleitungskomponenten aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen
(GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP) fest. Es eignet sich
für alle Wasservorsorgungs-, Entwässerungs- und Abwassersysteme, die unter
Druck oder drucklos betrieben werden. Zu den Wasserversorgungssystemen gehören
unter anderem Rohrleitungssysteme für Rohwasser, Bewässerung, Kühlwasser,
Trinkwasser, Salzwasser, Meerwasser, Druckstollen in Kraftwerken,
Verarbeitungsanlagen und andere wasserbasierte Anwendungen. Dieses Dokument
gilt für GFK-UP-Rohrleitungssysteme mit flexiblen oder starren Verbindungen mit
oder ohne Axialschubtragfähigkeit, die in erster Linie für den Einsatz in
direkt im Erdreich verlegten Rohrleitungssystemen bestimmt sind.
W 346-2 Arbeisblatt 12/2023
Preis ab:
62,03 €*
DVGW-Arbeitsblatt W 346-2 gilt für die
Inbetriebnahme von Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen und Stahl mit
Zementmörtelauskleidung für die Trinkwasserversorgung. Es ergänzt im
Hinblick auf die Inbetriebnahme von Guss- und Stahlrohrleitungen mit
Zementmörtelauskleidung in der Trinkwasserversorgung die Anforderungen
aus DVGW-Arbeitsblatt W 400-2, DIN EN 805 und DIN 2880.Die
Zementmörtelauskleidung von Rohren und Formstücken aus Gusseisen und
Stahl hat sich in der Wasserversorgung bewährt, um Korrosion und
Ablagerungen zu verhindern und damit gleichbleibende hydraulische
Eigenschaften in den Rohrleitungsanlagen dauerhaft zu erhalten.Als
anorganische Auskleidung hat sich der Zementmörtel unter hygienischen
und technischen Aspekten bewährt. Sowohl die Haftfestigkeit als auch die
mechanischen Festigkeiten der Beschichtung nehmen mit zunehmender
Betriebsdauer zu.Wegen der an die Rohrleitung gestellten
Anforderungen ist ein sorgfältiger Umgang mit den Rohrleitungsteilen bei
Transport, Lagerung und Einbau erforderlich, um Schäden in der
Zementmörtelauskleidung zu vermeiden.Für das Einfahren, das
Spülen, die Druckprüfung und ggf. die Desinfektion der installierten
Rohrleitungsanlage werden in diesem Arbeitsblatt praxisorientierte
Empfehlungen gegeben.Die im DVGW-Arbeitsblatt W 346
enthaltenen Angaben und beschriebenen Verfahren beruhen auf den
Empfehlungen der Rohrhersteller und langjährigen Betriebserfahrungen
zahlreicher Wasserversorgungsunternehmen.
W 346-1 Arbeitsblatt 12/2023
Preis ab:
39,92 €*
DVGW-Arbeitsblatt W 346-1 gilt für den Transport und die
Lagerung von Rohrleitungsteilen (Rohre und Formstücke) aus duktilem Gusseisen
und Stahl mit Zementmörtelauskleidung für die Trinkwasserversorgung. Es ergänzt
im Hinblick auf die Handhabung von Guss- und Stahlrohrleitungsteilen mit
Zementmörtelauskleidung in der Trinkwasserversorgung die Anforderungen aus
DVGW-Arbeitsblatt W 400-2, DIN EN 805 und DIN 2880. Das DVGW-Arbeitsblatt W
346-1 kann sinngemäß auch für Rohrleitungsteile zum Transport von Rohwässern
angewendet werden.Für das Einfahren, das Spülen, die Druckprüfung und ggf. die
Desinfektion der installierten Rohrleitungsanlage werden in diesem Arbeitsblatt
W 346-1 praxisorientierte Empfehlungen gegeben. Die in W 346-1 enthaltenen
Angaben und beschriebenen Verfahren beruhen auf den Empfehlungen der
Rohrhersteller und langjährigen Betriebserfahrungen zahlreicher
Wasserversorgungsunternehmen.
Die Zementmörtelauskleidung von Rohren und Formstücken aus
Gusseisen und Stahl hat sich in der Wasserversorgung bewährt, Korrosion und
Ablagerungen zu verhindern und damit gleichbleibende hydraulische Eigenschaften
in den Rohrleitungsanlagen dauerhaft zu erhalten. Als anorganische Auskleidung
hat sich der Zementmörtel unter hygienischen und technischen Aspekten bewährt.
Sowohl die Haftfestigkeit als auch die mechanischen Festigkeiten der Beschichtung
nehmen mit zunehmender Betriebsdauer zu. Wegen der an die Rohrleitung
gestellten Anforderungen ist ein sorgfältiger Umgang mit den Rohrleitungsteilen
bei Transport, Lagerung und Einbau erforderlich, um Schäden in der
Zementmörtelauskleidung zu vermeiden.